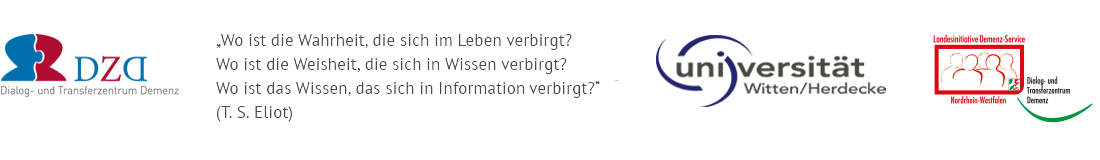Aus aktuellem Anlass: Im Rahmen unser neuen Serie “Neuer Expertenstandard: Pflege von Menschen mit Demenz” gibt es vorab zwei Beiträge für Sie, die zum besseren Grundverständnis beitragen, was diesen neuen Standard anbelangt. Denn im Zentrum dieses Standards stehen zum einen die personzentrierte Pflege, zum anderen der Beziehungsaspekt. Beide Aspekte spielen in unserer Neubesprechung des Klassikers “Demenz. Der personzentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen” von Tom Kitwood eine wichtige Rolle. Hier nun der zweite Teil: von der medizinischen Fragestellung in der Versorgung zum Beziehungsaspekt.
Vorbemerkungen von Marcus Klug
In seinem Klassiker “Demenz. Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen” schreibt der Sozialpsychologe Tom Kitwood: “Heutzutage wird Demenz überwiegend als `organisch bedingte psychische Erkrankung´ hingestellt, und ein medizinisches Modell, das ich als Standardparadigma bezeichnen werde, hat sich als vorherrschend erwiesen.”
Das war in den 1990-iger Jahren. Tom Kitwood steht mit seinem Werk für einen Perspektivwechsel. Ihm geht es um die Person hinter der Diagnose, die mit ihrer Krankheit als Mensch in Interaktion mit anderen Personen tritt. Das können professionelle Helfer wie Pflegende und Ärzte oder die Familie und Angehörige sein. Entscheidend ist, dass bei dieser Art von Interaktion drei verschiedene Ebenen mitschwingen.
Die Person mit ihrer neurodegenerativen Krankheit. Die Biologie. Die innere Befindlichkeit. Die Psychologie. Und schließlich der Kontakt zu anderen Menschen und der Umwelt. Die soziale Dimension. So spricht man vor diesem Hintergrund auch von einem Paradigmenwechsel, der sich dahingehend ausdrückt, dass Kitwood und seine Nachfolger wie unter anderem Ian Andrews James die eindimensionale medizinische Blickweise auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise ausgeweitet haben: der biopsychosoziale Ansatz.
So nimmt eine Frau, die von Demenz betroffen ist, auch weiterhin am sozialen Leben teil. Und so kann diese Frau auch Freude empfinden, wenn sie mit anderen Menschen lacht, musiziert oder kocht, auch wenn die Krankheit ihren Tribut zollt.
Vom Wohlbefinden zu psychologischen Bedürfnissen
Am Beginn von Kitwoods Auseinandersetzung mit Demenz stand die Vorstellung, dass sich Unwohlsein – etwa als Ergebnis von Traumatisierung – Menschen für die Demenz prädisponiert. Dem widerspricht nun aber, dass traumatisierte Personen nicht deutlich häufiger eine Demenz erleiden.
Diese nie ganz aufgegebene Vorstellung machte dann aber im Kontext von konkreten Beobachtungen dem Konzept Platz, dass Unwohlsein in der Demenz eher eine Folge ungünstiger Umgebungen und verweigerter oder schlechter Beziehung darstellt. Unwohlsein müsste damit eher schlechter, Wohlbefinden eher guter Pflege entsprechen. Je eher sich ein Mensch in seiner Demenz (relativ) wohl fühlt, weil er angenommen, verstanden, gehört und unterstützt wird, desto mehr kann er seine Ressourcen nutzen und am Ende Person bleiben.
Auch dieser Ansatz hatte seine Tücken: Es gibt doch Menschen, die unter schlechten Bedingungen dennoch sich ihres Lebens erfreuen und andere, die trotz günstiger Rahmenbedingungen und vielfältiger Zuwendung an ihrer Demenz verzweifeln.
Daran knüpft die “Gretchenfrage” an: Ist es wirklich so, dass eine gute Versorgung und Pflege das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz erhält oder ist die Macht der Krankheit größer und durchschlagender als alle Interventionen?
Diese Widersprüche lassen sich nur auflösen, indem man zugesteht, dass binäre Vorstellungen (Unwohlsein/Wohlbefinden) nicht weiter führen und es ein Zugleich unterschiedlicher Arten von Unwohlsein und Wohlbefinden gibt, die auf ganz unterschiedliche Weise äußeren Einflüssen unterliegen oder eben auch nicht.
An diesen Überlegungen knüpft in den letzten Werken Kitwoods das Konzept der (objektiven) psychologischen Bedürfnisse an. Eher aus konkreten Beobachtungen heraus entwickelte Kitwood 12 Indikatoren des Wohlbefindens wie z.B. Anerkennung, Beschäftigung, Zugehörigkeit, angemessene Stimulation, die eher einem “gelingenden Leben” und nicht hedonistischen Verständnis von Wohlbefinden entsprechen (also nicht ausschließlich auf Lust und Affekte ausgerichtet): ist man sozial eingebettet, sinnvoll beschäftigt, von anderen anerkannt, und lebt man in einer angemessenen und angepassten Umgebung, dann ist dies für das Wohlbefinden wichtig und entscheidend. Und zwar auch dann, wenn es sich nicht im mimischen Ausdrucksverhalten (Affekte) niederschlägt.
An dieser eher “objektivistischen Auffassung” von Wohlbefinden knüpft dann letztendlich die Idee der fünf psychologischen Bedürfnisse an: Tätigsein, Bindung, Identität, Trost und Inklusion. Zusammenfassend: das Bedürfnis, geliebt zu werden und lieben zu dürfen. Wohlbefinden und Erhalt des Personseins bedeuten nicht mehr und nicht weniger, dass diese Bedürfnisse zureichend erfüllt sind. Daher bedarf es einer reflektierten Praxis, herausforderndes Verhalten oder neuropsychiatrische Symptome insgesamt als Mangel an Bindung und Sicherheit zu rekonstruieren, als symbolischer und körperlicher Ausdruck unerfüllter, aber zentraler Bedürfnisse, die einer gezielten Intervention bedürfen.
Warum einige wichtige Fragen offen bleiben
Wie ist Kitwood auf diese fünf Bedürfnisse gekommen und wie begründet er diese Auswahl – dies hat er nicht gemacht ?! Dabei hätten sich vielfältige Anknüpfungen angeboten, z.B. Kompetenz, Verbundenheit und Autonomie (Ryan) oder der Dreiklang von Stimulans, Balance, Dominanz (Häusel) und viele ähnliche Bezüge mehr.
Was ist das Verhältnis von objektiven psychologischen Bedürfnissen und Affekt zu denken – also den objektiven und subjektiven Anteilen des Wohlbefindens? Wie kann man feststellen, ob die psychologischen Bedürfnisse erfüllt werden? Kann man aus dem äußeren Verhalten zuverlässig auf die subjektive Befindlichkeit schließen und ist letztere ein Indikator dafür, dass die objektiven Bedürfnisse erfüllt sind? Und wie messe ich subjektive Befindlichkeit, wenn nicht wieder am Affekt der Personen mit Demenz?
Obwohl gut versorgt und ohne erkennbare Traumatisierungen verzweifeln Menschen am Alter und an der Demenz – wie kann man dies erklären? Gute Umgebungen können nicht nur Wohlbefinden steigern, sondern – wie Kitwood zugibt – dazu beitragen, dass Menschen ihre Befindlichkeit ausgiebiger explorieren und – weil nicht durch Medikamente kontrolliert – negative Affekte wie Ärger, Projektionen, quälende Anspruchshaltungen akzentuierter leben.
Und dies ist dann zu begrüßen oder zu bedauern? Ist erkennbarer Ärger eher Ausdruck von Selbstbehauptung (positiv) oder von Unzufriedenheit (negativ) oder vielleicht von Beidem zugleich? Sind Menschen, die nicht tätig sein wollen und sich für andere interessieren, notwendigerweise unzufrieden und müssen sie als “apathisch” eingestuft werden, als teilnahmslos?
Und weiter: Wenn es dann Personen mit Demenz schlecht geht, haben dann notwendigerweise die Pflegenden “versagt” und sind gar “schuld”, da sie nicht in der Lage waren, zentrale Bedürfnisse zu identifizieren und zu erfüllen?
Daran knüpft die “Gretchenfrage” an: Ist es wirklich so, dass eine gute Versorgung und Pflege das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz erhält oder ist die Macht der Krankheit größer und durchschlagender als alle Interventionen?
Man könnte behaupten, dass in den 20 Jahren nach Kitwood die unterschiedlichsten Antworten und Theorien zu diesen Fragen angestellt wurden, ohne dass dies bislang zu einem übergreifenden Konsens geführt hat. Die grundlegenden Fragen, die sich aus Kitwoods Überlegungen ergeben, treiben Theorie und Praxis weiter um.
Das zentrale Konzept: Personsein
Das Konzept der zentralen psychologischen Bedürfnisse hängt eng zusammen mit dem Konzept des Personseins – erstere sollen Personen (nach-)nähren, aufbauen und erhalten. Auch inhaltlich grenzt sich personzentrierte Pflege ab von einer funktional orientierten Pflege: ein Sich-Kümmern um Menschen mit Demenz – so die Vorstellung – soll über eine möglichst gute Ernährung, eine erhaltene Mobilität, eine gute Bekämpfung von Schmerzen etc. deutlich hinausgehen. Und zwar im Sinne einer existenziellen oder “seelsorglichen” Begleitung, eines inneren, aber fachlich wohl fundierten Anteilnehmens und aktiven Eingehens auf den schwierigen Anpassungs- und Übergangsprozess, den die Demenz für die Betroffenen darstellt.
Pflegende stellen sich als sicherer Hafen und existenzieller Halt, als Bindungsobjekt zur Verfügung und vermitteln der Person mit Demenz das Gefühl, gehört, gesehen, angenommen und verstanden zu werden. Sie sind eine Art “existenzielles Hilfs-Ich” und arbeiten dem Gefühl der Verlorenheit, der Auflösung und der Angst entgegen.
Diese Position ist eng verbunden mit der theoretischen Perspektive des “sozialen Interaktionismus” und der Bindungstheorie: Die Natur des Selbst ist sozial und hängt von sozialer Interaktion ab (Sabat/Harre). Menschen werden zu Personen durch Beziehung, Anerkennung und Gemeinsam-Sein.
Demenz bedeutet in diesem Verständnis, dass sichere Bindung, Urvertrauen und höhere Selbstfunktionen erodieren und die Personen wieder einer äußeren, interaktiven Unterstützung bedürfen. Dies impliziert für die Pflegenden, über professionelle Rollen hinauswachsen und ein Wagnis einzugehen, das verbunden mit Spontaneität, Wärme, dem Zeigen von Gefühlen, mit Identifikation. Das Individuelle, Nicht-Ableitbare ist die Basis für Kontakt, nicht die eher distanziert-professionelle Rolle, die jeden “gleich” behandelt (“Uniformierung”).
Mit dem Konzept des Personseins betrat Kitwood allerdings ein philosophisch hoch umstrittenes Terrain. Zuweilen entging er nicht der begrifflichen Konfusion zwischen der eher metaphysisch-analytischen Frage nach dem, was Personsein bedeutet, und der eher ethisch-moralischen Frage, was dies an Folgen für Interaktion und Verhalten mit sich bringt.
Kritisch ist zu diesem Ansatz zu vermerken, dass damit das Personsein von Menschen mit Demenz (und in der Tat von allen Menschen) in nichts Grundlegenderem verankert ist als der aktuellen sozialen Praxis, Menschen (mit Demenz) als Person anzuerkennen. Soziale Praktiken können sich verändern: Es ist durchaus ein gesellschaftlicher Diskurs vorstellbar, der im Rahmen einer metaphysisch-analytischen Fähigkeitsorientierung – unterfüttert von ökonomischen Interessen – die Erfüllung gewisser, in der Regel kognitiver, Merkmale zur Voraussetzung sozialer Anerkennung macht.
Das hyperkognitive Menschenbild ist mit Selbsterschaffung, Selbsterfüllung, Autonomie und ökonomischer Produktivität unlösbar verbunden. Mit der Demenz wird – im Rahmen dieses Selbstverständnisses – eine unsichtbare Linie überschritten, die das Ende des Personseins markieren könnte.
Dass Menschen mit Demenz Personen bleiben – abstrakt und konkret – scheint von der Verantwortung und sozialen Praxis derer abzuhängen, die nicht an Demenz leiden und deren Menschenbild. Es ist auch eine gesellschaftliche Fragestellung. Man fühlt sich an die aktuellen Diskurse zur Inklusion und Exklusion erinnert. Somit biegt sich der Spaten (die Frage nach dem Personsein der “Anderen”) auf “uns” (die Nicht-Dementen) zurück: Ob wir eine Praxis an den Tag legen wollen, die Menschen mit Demenz zu Personen macht. Und ob wir diese Praxis auch weiterhin mit einem Menschenbild verknüpfen wollen, das nicht unlösbar mit Selbsterschaffung, Selbsterfüllung, Autonomie und ökonomischer Produktivität verbunden ist: das hyperkognitive Menschenbild.
Quellenangabe zum Titelfoto:
Foto: Linda Pleis / www.flickr.com
Christian Müller-Hergl ist Philosoph und Theologe. Er arbeitet u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Dialog- und Transferzentrum (DZD) an der Universität Witten-Herdecke. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Themen Demenz und Gerontopsychiatrie. Er ist zudem strategischer Leiter und Trainer für Dementia Care Mapping-Verfahren, eine ursprünglich von Tom Kitwood und Kathleen Bredin in England entwickeltes personenzentriertes Evaluations- und Beobachtungsverfahren. Kontakt: Christian.Mueller-Hergl@uni-wh.de.
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.