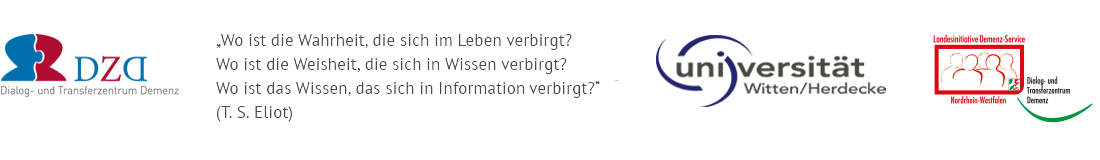Herausfordernde Verhaltensweisen wie Angst und Apathie können in der Pflege von Menschen mit Demenz zu anhaltendem Stress führen. Jörg Killinger erklärt im Interview aus der Perspektive eines Psychobiologen, inwieweit Emotionen und Stress zusammenhängen, was das mit unserem Gehirn und unseren Genen zu tun hat, und welche Strategien gegen zu viel Stress helfen.
Herausfordernde Verhaltensweisen wie Angst und Apathie können in der Pflege von Menschen mit Demenz zu anhaltendem Stress führen. Jörg Killinger erklärt im Interview aus der Perspektive eines Psychobiologen, inwieweit Emotionen und Stress zusammenhängen, was das mit unserem Gehirn und unseren Genen zu tun hat, und welche Strategien gegen zu viel Stress helfen.
Am Donnerstag, den 26. Juni 2014, hielt der Psychobiologe Jörg Killinger auf dem Gesundheitskongress in Berlin einen Vortrag zum Thema “Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz – Grenzen der Empathie”. Ich war im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) auf dem dreitägigen Gesundheitskongress in Berlin unterwegs und besuchte relativ viele Vortrags- und Diskussionsrunden.
Killinger referierte im Rahmen des Themas “Pflegeberufe, mal ehrlich: Macht die Arbeit am Patienten krank?”. Viele Pflegende kennen dieses Problem nur allzu gut aus ihrem eigenen beruflichen Alltag: Wir haben häufig nur recht wenig Zeit für einzelne Personen in der Pflege. Wird die Pflege zusätzlich noch dadurch erschwert, dass wir häufiger mit herausfordernden Verhaltensweisen und negativen Emotionen konfrontiert werden, ist die Grenze der Belastung relativ schnell erreicht. Beiträge zur Überforderung am Arbeitsplatz und zu Burnout gibt es allerdings in den letzten Jahren wie Sand am Meer; umso ungewöhnlicher war für mich dementsprechend die Perspektive von Killinger auf dem Gesundheitskongress zu der Frage: “Macht die Arbeit am Patienten krank?”
Jörg Killinger ist seit vielen Jahren als Berater unterwegs. Vor dieser Tätigkeit hat er u. a. wissenschaftliche Untersuchungen am Max-Planck-Institut für Verhaltensethologie und Humanethologie durchgeführt (Ethologie bedeutet vergleichende Verhaltensforschung; Anm. der Redaktion). Heute berät er etwa Pflegende und Pflegeteams zu Überforderung und Stress – bedingt durch den Umgang mit Emotionen – aus psychobiologischer Sicht. Zu seinen Kunden gehören die Charité in Berlin, der Deutsche Berufsverband für Krankenpflege Nordost, das Landeskriminalamt in Berlin, ebenso Hospize und Seniorenzentren.
Im Interview mit ihm geht es um das Verhältnis von Nähe und Distanz, um die Psychobiologie im Pflegekontext, um Menschen mit Demenz und um Emotionen unter der Lupe der Epigenetik (die Epigenetik beschäftigt sich mit der Frage, wie die Umwelt unser Erbgut beeinflusst; Anm. der Redaktion).
Herr Killinger, Sie haben auf dem diesjährigen Gesundheitskongress in Berlin einen Vortrag zum Thema “Professioneller Umgang mit Distanz und Nähe. Die Grenze der Empathie” gehalten. Warum ist dieses Thema in Gesundheitsberufen – insbesondere in der Pflege – von Bedeutung?
Pflege wird im Berufsalltag häufig mit negativen Emotionen wie zum Beispiel Trauer und Ekel konfrontiert. Im Umgang mit Emotionen spielt Empathie eine Schlüsselrolle. Dabei kommt es im professionellen Umgang mit Distanz und Nähe in der Pflege darauf an, wie Empathie “gefiltert” wird. Besteht etwa im Umgang mit solchen negativen Gefühlen wie Trauer und Ekel nicht genügend Distanz trotz Anteilnahme, kann Empathie in ein zu viel an Mitgefühl und schließlich in Mitleid umschlagen. Die beteiligten Pflegekräfte werden dann zu Betroffenen. Als Folge können Burnout und emotionale Erschöpfung daraus resultieren.
Für den professionellen Umgang mit negativen Emotionen ist daher ein Training der kognitiven Empathie die Grundvoraussetzung. Darunter versteht man die Fähigkeit, sich geistig in die Lage des anderen zu versetzen, zu verstehen, was mein Gegenüber fühlt, ohne darunter zu leiden. Der Übergang von Mitgefühl in kognitive Empathie kann zudem nur durch bewusste Kognition erfolgen – als das Wahrnehmen der emotionalen Situation des Gegenübers, ohne diese Emotion ungefiltert zu übernehmen.
Denken und Intuition brauchen länger und “verbrauchen” zudem ein hohes Maß an Energie. Unter Stress nehmen die emotionalen Anteile der Verhaltenssteuerung stark zu. Es sind quasi die “Hauptstraßen” des Verhaltens. – Jörg Killinger
Achtsamkeitsübungen bieten hier eine wertvolle Ergänzung. Wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen dazu beitragen können, sich stärker zu konzentrieren, das körperliche und mentale Wohlbefinden zu verbessern, aber gerade auch Ängstlichkeit, Angstneigung und negative Emotionen abzubauen. Ein empfehlenswertes Übungsprogramm ist in diesem Zusammenhang die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR), die von dem Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn in den späten 1970er Jahren in den USA entwickelt wurde (siehe dazu auch das in diesem Beitrag integrierte Video “Mindfulness-Based Stress Reduktion”, in dem Jon Kabat-Zinn selbst zu Wort kommt).
Sie selbst sind Psychobiologe. Was macht ein Psychobiologe als Trainer und Berater im Gesundheits- und Pflegekontext?
Als beratender Psychobiologe geht es prinzipiell darum, einen möglichst ganzheitlichen Blick auf das Geschehen im Gesundheits- und Pflegekontext einzunehmen, beispielsweise wenn man für ein bestimmtes Krankenhaus im Rahmen von Trainings, Supervisionen und Coachingsprozessen tätig ist. Es geht um Zusammenhänge zwischen Emotionen, Verhalten und Erleben und um die wissenschaftliche Betrachtungsweise dieser Zusammenhänge. Der Biologischen Psychologie liegt die Annahme zugrunde, dass körperliche Prozesse Basisvorgänge des psychischen Geschehens sind. Dementsprechend bezieht sich die Beratung zum einen auf das Wissen um die ablaufenden Verhaltensprozesse im psychsomatischen Kontext, zum anderen kann man mit dem psychobiologischen “Blick” durch die Begleitung von Teams oder Einzelpersonen nachhaltige Lern- und Veränderungsprozesse anstoßen. Die Akzeptanz dieser Sichtweise wird zudem durch den naturwissenschaftlichen Rahmen der Psychobiologie speziell bei Pflegekräften sowie bei Ärzten und Ärztinnen verstärkt.
Wie würden Sie die Schwerpunkte der Psychobiologie beschreiben und welche Perspektive wird durch die Psychobiologie auf Gefährdungen am Arbeitsplatz in der Pflege geworfen, insbesondere im Umgang mit Emotionen?
Die Psychobiologie versucht, Verhaltensmuster aus biologischen, biochemischen, psychologischen und gesellschaftlichen Hintergründen zu erklären. Ursprünglich in den angelsächsischen Ländern entstanden, ist sie seit den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts auch bei uns in Deutschland angekommen. Der Schwerpunkt der deutschen psychobiologischen Forschung und der Untersuchungen liegt in der ganzheitlichen Stressforschung und der Bindungstheorie bzw. evolutionsbiologischen Ansätzen zur menschlichen Entwicklung. Ich habe mich in meiner Forschungstätigkeit vor allem mit schnellen menschlichen Emotionen, der non-verbalen Kommunikation, speziell der Mimik, auseinandergesetzt und ihren Wechselwirkungen im Körper sowie genderspezifischen Aspekten.
Vor allem symmetrische Kommunikations- und speziell Gesprächsmuster wirken unmittelbar auf das Gegenüber und haben offenbar einen positiven Einfluss auf die Stärke sowie die Bewältigung des psychosozialen Stressgeschehens. In einer symmetrischen Beziehung sind die Kommunizierenden ebenbürtig oder versuchen zumindest, einen Rangunterschied zu verringern. Dies kann sich beispielsweise darin ausdrücken, dass alle etwa gleichviel, gleichlaut oder betont sprechen.
Sie beschäftigen sich auch mit emotionaler Erschöpfung. Was sind die Ursachen für eine derartige Form der Erschöpfung?
An erster Stelle steht natürlich Stress in seiner negativen Form. Allerdings ist selbst negativer Stress nicht gleich pathologisch. Es geht eher um die Frage, wie lange Stress anhält, ob ein bestimmter kritischer Wert überschritten wird und inwieweit damit biochemische Abläufe in Gang gesetzt werden, die als erste Stufe chronischer Erschöpfung anzusehen sind. Wenn dann noch eine fehlende Sinnhaftigkeit der erlebten Stresssituation hinzukommt und eine geringe Wertschätzung des Arbeitseinsatzes droht für den Menschen emotionale Erschöpfung mit weitreichenden Folgen für die Patienten bzw. die Mitmenschen. Der Stress wirkt sich dann wechselseitig auf die Beziehung zwischen professionellen Gesundheitskräften und denjenigen Menschen aus, die von diesen Kräften betreut werden.
In Ihrem Vortrag auf dem diesjährigen Gesundheitskongress in Berlin sprachen Sie auch von so genannten “epigenetischen Spuren”. Können Sie einmal näher ausführen, was damit gemeint ist, und inwieweit solche Spuren ein Indikator für unterschiedliche Reaktionen auf Stress sind?
Als Epigenetik bezeichnet man ein Phänomen, bei dem emotionale Ereignisse und individuelle Erlebnisse auf die nächste und übernächste Generation übertragen werden. Die Frage in der Epigenetik lautet: Wie können erworbene Eigenschaften über Generationen vererbt werden?. Dabei ist die epigenetische Weitergabe nicht so dauerhaft wie die genetische Vererbung (siehe zum Thema Epigenetik ebenso das unterhalb dieses Abschnitts angeführte Video “Epigenetik: Das Gen-Gedächtnis – Sind Traumata vererbbar?”). Es werden vor allem die chemischen Markierungen und damit die Methylgruppen – als epigenetische Marker an den Genen – verändert. Entwickelt sich eine Stammzelle zu einem bestimmten Zelltyp, werden nach einer festgelegten Reihenfolge Gene an- und wieder abgeschaltet. Dies gelingt durch epigenetische Programmierung. Dabei muss die Zelle, um stillgelegte Gene wieder anzuschalten, so genannte Methylgruppen von der DNA entfernen.
Zur Erinnerung: DNA oder DNS bedeutet “DesoxyriboNukleinSäure”. Die DNS ist ein in allen Lebewesen vorkommendes Biomolekül und Träger der Erbinformation, also der Gene. Zum Zusammenhang von Genen und Methylgruppen siehe auch folgenden lesenswerten Online-Beitrag: Gene anschalten auf Umwegen.
Erben Kinder beispielweise diese so bestückten Gene von ihren Eltern, verändert dies die körperlichen und vor allem auch die neurobiologischen Strukturen und Adaptionen im Gehirn – die Fähigkeit zur Anpassung. So kann es sein, dass die Stressanfälligkeit ansteigt und somit die Fähigkeit zur Resilienz (Widerstandsfähigkeit) abnimmt. Ebenso wird diskutiert, dass Ängstlichkeit als eine Erhöhung der Grundspannung des Individuums über bis zu drei Generationen weitergegeben werden könnte. Hinzu kommt, dass es Untersuchungen gibt, die einen verstärkenden Einfluss des mütterlichen Stresserlebens während der Schwangerschaft nachweisen konnten – vor allem nach dem siebten Schwangerschaftsmonat. Hat die Mutter durch epigenetischen Einfluss eine höhere emotionale und körperliche “Grundspannung” geerbt, kann es dann dementsprechend zu einer systemischen Verstärkung dieser biochemischen und neuronalen Genese auf das heranwachsende Kind kommen. Die nächste Generation wird in ihrem Stresserleben somit verändert. Sie ist weniger resistent gegen Stress.
Was hat das mit der Helferproblematik in der Pflege zu tun?
Die sogenannte “Helferproblematik” ist meines Erachtens nach eine spezielle Form der narzisstischen Persönlichkeit (siehe dazu auch folgenden Link: Helfersyndrom), die häufiger bei Frauen auftritt. Durch das unbedingte Helfen, eventuell bis zum Aufopfern und sich selbst verlieren, kann ich meine Gefühle von unbewusster Ohnmacht und fehlender Wertigkeit gesellschaftlich und sinnhaft akzeptiert kompensieren. Zudem haben viele Helfer unter Umständen epigenetische Spuren und frühe negative Bindungserfahrungen in ihren neuronalen Netzwerken aufgebaut und eingespeichert. Sie sind somit sehr schwer in der Lage, ihre tiefliegenden und tiefverwurzelten Handlungsimpulse bewusst wahrzunehmen, klar Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Gerade der Präfrontallappen (Affektkontrolle) und das limbische System (das limbische System ist eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient; Anm. der Redaktion) haben in diesem Falle bestimmte neuronale Abläufe tief konditioniert.
Zudem gibt es erste Anzeichen dafür, dass “Helfer” statistisch häufiger Hilflosigkeitserfahrungen (chronische Angst und Trauer) in ihrer frühen Kindheit erfahren haben – die sie zum einen sensibler für emotionale Muster beim Gegenüber machen und sie damit im Sinne einer emotionalen Übertragung für Hilfesuchenden attraktiv als “Ansprechpartner” werden. Der eine sucht Hilfe und der andere bietet sich an. Dies alles geschieht meistens in Millisekunden und unterbewusst. Zwei biochemische Abläufe wirken hier als Trigger: Der Ausstoß von Dopamin (Neurotransmitter) setzt den Handlungsimpuls und vergrößert die sprachlichen Fähigkeiten und Oxytocin (Bindungshormon) verstärkt das Mitgefühl und die Kommunikationsbereitschaft. Diese Abläufe sind zudem bei mittlerem Stress (siehe oben) stärker bei Frauen zu finden (siehe zu Forschungen zum Bindungshormon Oxytocin auch das angeführte Video im unteren Teil dieses Interviews: “Bindung, Oxytocin und Depression”).
Der Umgang mit Emotionen spielt gerade auch in der Beziehung zu Menschen mit Demenz in der Pflege eine herausragende Rolle. Vielfach sind die Emotionen etwa bei Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind, stark ausgeprägt, während kognitive Kontrollmechanismen zunehmend versagen. Wie betrachten Sie derartige Tendenzen als Psychobiologe?
Dies ist eine schwierige Frage und kann hier nur knapp beantwortet werden. Die emotionalen Muster und Abläufe sind in den neuronalen Netzen und Strukturen zum Teil schon genetisch, epigenetisch und pränatal (vor der Geburt) angelegt. Lern- und Erfahrungsprozesse werden dann im Moment der Geburt prägend. Jeder Mensch lernt mit zunehmendem Alter die Herausforderungen der Umwelt zu erkennen und ihnen individuell zu begegnen. Unsere Gehirne und unsere körperlichen Strukturen sind ein Leben lang hochgradig adaptiv, also hochgradig selbstregulierend. Die Basis des Handelns sind hierbei Emotionen und Gefühle. Sie sind zudem schneller als die Kognition. Denken und Intuition brauchen länger und “verbrauchen” zudem ein hohes Maß an Energie. Unter Stress nehmen die emotionalen Anteile der Verhaltenssteuerung stark zu. Es sind quasi die “Hauptstraßen” des Verhaltens. Bei neurodegenerativen Erkrankungen (Hirnerkrankungen) werden wahrscheinlich daher diese emotionalen “älteren” Verhaltensstrukturen und Muster stärker aktiviert, um dem Individuum Verhaltensoptionen für verlorengegangene Kognitionsmuster zu bieten.
Was können professionelle Pflegekräfte und Leitungskräfte unternehmen, wenn sie häufiger mit herausforderdernden Verhaltensweisen wie etwa Schreien und Rufen oder Aggression konfrontiert werden? Auf welche Erfahrungswerte können Sie diesbezüglich aus Ihrer eigenen Praxis zurückgreifen?
Nach meinen Erfahrungen sind die Grenzen der emotionalen Belastbarkeit von professionellen MitarbeiterInnen im Pflegealltag unterschiedlich hoch, je nach Alter und Erfahrungshintergrund. Oft merken die einzelnen MitarbeiterInnen im Stress des Alltags nicht, wann eine bestimmte Grenze erreicht oder gar überschritten ist. Zudem hat nonverbales Verhalten – in Form von unbewussten emotionalen Übertragungen – eine psychosoziale Wirkung. Zwischen dem “Sender” und dem “Empfänger” werden diese Emotionen übertragen und es kommt zu Projektionen. Es entstehen somit “emotionale Wechselwirkungen”, die damit verstärkend auf die negativen Verhaltensweisen einwirken.
Die Folge ist ein starker psychosomatischer Stresslevel, der unter Umständen auch einen Anstieg von Aggressionen implizieren und das Auftreten von Gewalt beinhalten kann. Dieser Spannungsaufbau steigert sich während des Dienstes. Hier helfen nach meiner Erfahrung vor allem zwei Dinge: Zum ersten ist es wichtig, regelmäßig kurze “Auszeiten” zu nehmen. Diese “Auszeiten” können beispielsweise in der Form von kleinen Achtsamkeitsübungen erfolgen, etwa bewusstes Atmen, Aufrichten und ein Schluck Wasser und Fruchtsaft trinken, um Spannungen wieder abzubauen. Dabei müssen diese “Auszeiten” nicht länger als drei bis fünf Minuten andauern. Zum zweiten braucht es in Arbeitsumgebungen mit häufigem herausforderndem Verhalten (etwa Pflege von demenzkranken Menschen, psychiatrischen Stationen und Suchtpatienten) ein starkes Team, welches sich gegebenenfalls in einer emotionalen Grenzsituation gegenseitig unterstützt und den Stress gut verteilen kann. Das bedeutet beispielsweise, dass unter negativen Umständen ein Kollege/eine Kollegin bewusst aus einer stressigen Situation herausgezogen wird, indem dieser Person eine Pause angeboten wird. Zudem braucht es nach einem Arbeitstag mit vielen herausfordernden Situationen eine kurze Zeit der bewussten Kontemplation und kommunikativen Ruhe – am besten mit rhythmischen Bewegungsmustern wie beispielsweise kurz spazieren gehen.
Zuweilen lassen sich Emotionen in den Gesichtern von Menschen mit Demenz nicht mehr so ohne Weiteres “richtig” interpretieren. Gibt es alternative Lösungsansätze und Strategien aus der Psychobiologie, die hier weiterhelfen? Was raten Sie Pflegenden, die sich in einer solchen Situation befinden?
Mimik und Gestik sind universelle Verhaltens- und Kommunikationsmuster. Dabei wird vor allem die Mimik in ihrer Feinmotorik und Ausprägung durch Lern- und Konditionierungsprozesse bereits in der frühen Kindheit geprägt. Zwischen dem Außen – muskuläre Bewegungen des Ausdrucksverhaltens (etwa die Gesichtsmuskeln) – und dem Innen – in Form von aktiven Stoffwechselgeschehen und neuronalen sowie biochemischen Reaktionen – gibt es klare Wechselwirkungen. Dieses Phänomen wird “Facial-feedback” genannt. Bei Menschen mit dementiellen Erkrankungen sind auch diese Strukturen betroffen, ähnlich wie bei Morbus Parkinson. So ist bei Personen mit Morbus Parkinson die Dopaminausschüttung gestört und die damit die Feinmotorik der Mimik – schon in frühen Stadien der Erkrankung. Die Mimik wird maskenhaft und zeitverzögert. Dies führt zu Kommunikationsschwierigkeiten sowie zu Missdeutungen beim Patienten und ebenso bei den Menschen in ihren sozialen Bezugssystemen.
Neben der Mimik helfen dabei aber auch die genaue Analyse und Beobachtung der anderen Körpersprachsysteme wie die Bewegungen, das Atmen, Unruhe beim Verhalten und bei fortschreitender Demenz auch Techniken der basalen Stimulation, um mit dem Patienten, der Patientin oder Bewohnerin in emotionalen Kontakt zu treten.
Wenn die Betrachtung des Gesichtsausdrucks nicht mehr klare Informationen erkennen lässt, hilft es, einen bewusst ganzheitlichen Blick auf das emotionale Geschehen anzuwenden und achtsam sowohl die Gestik, die Stimme und den sozialen Kontext zu betrachten und einzuschätzen. Ein wichtiger Impuls in der Kommunikationssteuerung wird durch sanfte Berührungen und gemeinsames rhythmisches Bewegen, Schaukeln und derartige Dinge ausgelöst. Dies führt zur Ausschüttung von Oxytocin (Bindungshormon) und baut sofort Stress und Angst ab.
Herr Killinger, vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Marcus Klug. Besuchen Sie auch die Homepage von Jörg Killinger zum Schwerpunkt “Psychobiologie”. Hier der Link: www.psycho-biologie.de.
Quellenangabe des Titelfotos:
Foto: Eugene Hamill / www.flickr.com
Jörg Killinger ist Inhaber von Killinger Networking – Beratung, Coaching, Networking, Berlin, Schwerpunkte: supervisorische Begleitung von Teams, Coaching von Führungskräften und Workshops zur Personalentwicklung, hauptsächlich im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen; Studium der Volkswirtschaftslehre, Biologie und Psychologie. Kontakt: joerg.killinger@gmx.de.
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.