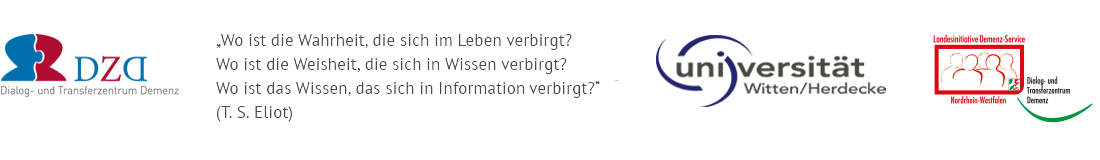Gerald Hüther hat ein Buch zur Biologie der Angst geschrieben. Aus Angst und Ohnmacht kann Zuversicht entstehen. Gilt das auch für den Umgang mit Demenz? Oder täuscht die Hoffnung?
Gerald Hüther hat ein Buch zur Biologie der Angst geschrieben. Aus Angst und Ohnmacht kann Zuversicht entstehen. Gilt das auch für den Umgang mit Demenz? Oder täuscht die Hoffnung?
Am Anfang des Buches “Biologie der Angst. Wie aus Streß Gefühle entstehen” von Gerald Hüther (2016) gibt es ein wirklich imposantes Bild.
Dort, wo Hüther wohnt, gibt es einen kleinen Hügel. Es führt ein einsamer grasbewachsener Weg hinauf und nur selten verirrt sich ein Mensch hierher. Steht man oben auf dem Hügel, schaut man weit ins Land. Man sieht ein Netz von Straßen und Wegen und man sieht die Menschen mit ihren Autos und Fahrrädern, die von hier oben wie Ameisen aussehen. Manchmal, so Hüther, bleibt er einfach ein bißchen auf dem Hügel stehen. “Nur wer still steht, sieht, wie die anderen sich fortbewegen, sieht, wohin sie immer wieder gehen und welche Spuren sie dabei hinterlassen.”
Diese Eindrücke, dieses Netzwerk von Straßen und Wegen ist vergleichbar mit unserem Gehirn, denn in Abhängigkeit von der Nutzung verändert sich auch die Art und Weise, wie die Straßen und Wege beschaffen sind, wo sie weiterlaufen und sich verästeln, wo sie aber auch enden und nicht mehr weiter gehen.
Nun können wir im Hinblick auf Angst schnell zu der Ansicht gelangen, dass diese das Wachstum eher lähmt als befördert. Und im Falle von Demenz stellen wir uns vor diesem Hintergrund vielleicht eher eine Winterlandschaft vor, die ihre Blüte bereits hinter sich gebracht hat.
Aber ist das wirklich so? Und wie sieht es eigentlich mit der Angst aus, psychobiologisch betrachtet? Kann aus Angst vor Demenz auch Zuversicht entstehen? Oder ist die Hoffnung verloren?
Die Biologie der Angst
Es gibt im Leben sehr einschneidende Phasen. Diese einschneidenden Lebensabschnitte zeugen von einigen grundlegenden biopsychologischen Erkenntnissen, die auch Gerald Hüther in seinem Buch “Biologie der Angst” ausführlicher unter die Lupe nimmt. Vor allem eine Erkenntnis.
Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang zunächst solche Umbruchsphasen wie die Pubertät oder andere psychosoziale Schwellensituationen vor. Ein junger Mann, der sich noch stark in der Entwicklung befindet, erlebt mit der Pubertät eine recht schwierige Lebensphase. Schwierig deshalb, weil sein Denken, Fühlen und Handeln plötzlich viel intensiver ins Schwanken gerät. Die Gefühlsschwankungen sind größer, die Ängste und Unsicherheiten auch.
Diese Situation ist zunächst nicht kontrollierbar. Einzelne Ängste treten auf, die wir vorher so vielleicht noch nicht kannten. Und ob wir diese Ängste nun verdrängen oder nicht, ob wir so tun, als ob wir an sich alles im Griff haben, ändert nichts daran, dass diese Lebensphase mit heftigeren emotionalen Schwankungen einhergeht. Im Umgang mit unseren Ängsten sprechen wir von kontrollierbaren und unkontrollierbaren Ängsten.
Im Gehirn bahnen sich in dieser Schwellensituation neue plastische Veränderungen an. Alte Wege werden abgebrochen, neue Wege miteinander verbunden. Das verursacht Schmerz.
Auf dieser Grundlage fällt mir auch das Bild eines älteren Menschen und seines familiären Umfeldes ein, der mit der Diagnose Demenz konfrontiert wird. Rein psychologisch betrachtet könnte dieser Schmerz als Ausdruck einer größeren psychosozialen Schwellensituation auch mit einer Depression verbunden sein. Auf dieser Ebene ist die Pubertät mit der Demenz bedingt vergleichbar. Denn in derartigen Schwellensituationen tritt die Depression häufiger auf den Plan, in gewisser Weise auch als “Wachstumsschmerz”. Bezeichnenderweise charakterisiert Riemann die Depression daher auch als “Angst vor der Ich-Werdung”.
Während allerdings der junge Mensch Angst vor der Ich-Werdung empfindet – im Falle der Pubertät –, fürchtet sich der alte Mensch – im Falle der Demenz – vor der Ich-Auflösung. In beiden Fällen können wir diese Angst ein wenig relativieren, wenn wir sie mehr von ihrer Natur aus begreifen.
Zwei Beobachtungen sind dabei zunächst entscheidend:
- Die Angst bildet einen lebensnotwendigen Mechanismus, um diese größeren Veränderungen bis zu einer gewissen Grenze zu stabilisieren. Eine vorübergehende Depression kann in diesem Zusammenhang deshalb durchaus als positiv bewertet werden.
- Auch im Alter lernt der Mensch noch weiter dazu – auch bei Demenz. Der unkontrollierbare Stress, der jetzt aber durch die neue Schwellensituation stärker hervortritt, repräsentiert zunächst überwiegend degenerative Veränderungen von neuronalen Verschaltungen, die ausgelöscht und destabilisiert werden.
Neurobiologisch ausgedrückt: “Die mit unbewältigbaren Belastungen einhergehenden langanhaltenden neuroendokrinen Veränderungen (…) können offenbar – über die von ihnen ausgelösten plastischen Veränderungen neuronaler Verschaltungsmuster in limbischen und kortikalen Hirnregionen, vor allem durch die Destabilisierung und Auflösung bisher stabilisierter Verbindungen – zu sehr grundsätzlichen Veränderungen des Denkens, Fühlens und Handelns eines Individuums führen.”
“Ein solcher Prozess geht”, so Hüther, “je länger er anhält, mit einer zunehmenden Labilisierung und der Gefahr der Dekompensation des Individuums” einher. Auf Demenz bezogen würden wir von der “Ich-Auslöschung” sprechen.
Einzelne Zellen im Gehirn unterliegen einer pathologischen Veränderung; es bilden sich neue Verschaltungsmuster aus, während andere absterben, so in etwa die Erklärung zu dem Begriff der “neuroendokrinen Veränderungen”. Ganz charakteristisch für diese Angst ist auch die Forschungssituation, denn in der Stressforschung, so Hüther, wurden bislang fast ausschließlich die pathogenen Auswirkungen unkontrollierbarer Belastungen betrachtet.
Was aber, wenn das nur die halbe Wahrheit ist? Wenn neben der Winterlandschaft, die nicht mehr die nächste Blüte erleben wird vor einem Horizont, der immer dunkler wird, das Licht längst wieder zu strahlen begonnen hat?
Hüther drückt diese bedeutsame Erkenntnis so aus: “Wer ein Programm hat, das nicht geeignet ist, die Angst kontrollierbar zu machen, ist verloren. Das ist das uralte biologische Gesetz, an dem bereits die Saurier gescheitert sind (…) Ich glaube das nicht, denn es war ja eigentlich nichts anderes als das, was wir tagtäglich erleben. Alles um uns herum, was lebendig ist und in seiner Harmonie gestört wird, versucht mit allen Mitteln, die verlorengegangene Harmonie wiederzufinden, zunächst die alte, und wenn das nicht geht, eben eine neue.”
Was bedeutet das auf Demenz bezogen?
Es ist durchaus strittig, ob Menschen mit Demenz überhaupt positive Erfahrungen machen können. Die Forschung bezüglich des Erlebens von Menschen mit Demenz ist von krankheitsgeleiteten, negativen Perspektiven geprägt. Im Kontrast dazu stehen wenige Forschungsarbeiten, die das aktive Suchen nach Freude, Erfüllung, Liebe, Hoffnung und Humor zum Thema haben. Letztere Forschungen machen deutlich, dass Demenz nicht nur eine negative Erfahrung darstellt, sondern im Kontext positiven Alterns integriert werden kann.
Quellenangabe zum Titelfoto:
Foto: Rick Finster / www.flickr.com
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.