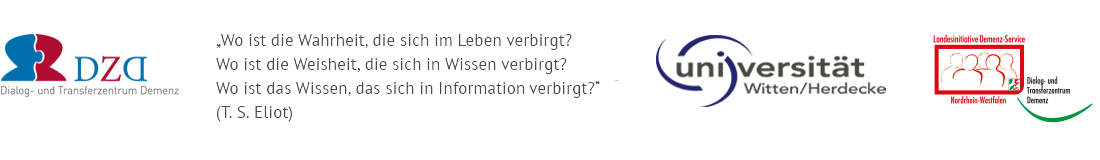Es gibt eine Aktion von Joseph Beuys aus dem Jahre 1965 mit dem Titel: “Wie man den toten Hasen die Bilder erklärt”. Man kann einen toten Hasen selbstverständlich keine Bilder erklären. Ich interpretiere den Titel daher so: Nur wer sich auf die Umwelt einlässt, gewinnt echtes Verständnis für deren Wirkungsmächte. Im Interview mit der Wissenschaftsjournalistin und Biologin Christina Berndt geht es um einen ähnlichen Zusammenhang: Inwieweit spielt bei dem Geheimnis der psychischen Widerstandskraft die Umwelt eine Rolle?
Es gibt eine Aktion von Joseph Beuys aus dem Jahre 1965 mit dem Titel: “Wie man den toten Hasen die Bilder erklärt”. Man kann einen toten Hasen selbstverständlich keine Bilder erklären. Ich interpretiere den Titel daher so: Nur wer sich auf die Umwelt einlässt, gewinnt echtes Verständnis für deren Wirkungsmächte. Im Interview mit der Wissenschaftsjournalistin und Biologin Christina Berndt geht es um einen ähnlichen Zusammenhang: Inwieweit spielt bei dem Geheimnis der psychischen Widerstandskraft die Umwelt eine Rolle?
Es gibt viele schöne Märchen und Mythen aus der modernen Arbeits- und Gesundheitswelt. Eines dieser Märchen lautet so: Wenn Du es nicht schaffst, dann liegt es halt an Dir! Selbst die Resilienzforscher, also solche Leute, die sich mit Widerstandsfähigkeit und Stressbewältigung professionell beschäftigen, sind über lange Zeit davon ausgegangen, dass der Widerstandsfaktor bei uns Menschen stark mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Choleriker hätten dann beispielsweise immer mehr Stress als eher introvertierte Persönlichkeiten, da sie sich immer so unglaublich verausgaben, wenn wieder einmal Stress droht. Am Höhepunkt der Persönlichkeitsmythen angelangt, glaubte man gar, es gebe so etwas wie eine bestimmte Kaste von Menschen, denen Stress per se nichts anhaben kann: die “Invulnerablen” – die Unverwundbaren. Heute ist man von diesem Käse zum Glück abgekommen. Der Umweltbezug wird immer wichtiger in der Resilienzforschung und dementsprechend auch die Frage nach den Genen.
Im Interview mit der Wissenschaftsjournalistin und Biologin Christina Berndt wird das Geheimnis der psychischen Widerstandsfähigkeit zumindest teilweise gelüftet. Selbst Gene sind keineswegs unveränderlich, wie lange gedacht worden ist. So kann die Mutter beispielweise einige ihrer besonders ausgeprägten Ängste weitervererben, jedoch leitet sich daraus kein starres Prinzip ab, das auf ewig in den Erbanlagen einer Familie einprogrammiert sein muss: lauter total unglückliche und gehemmte Menschen über Generationen ![]()
Frau Berndt, vielfach wird in der Resilienz-Forschung behauptet, dass psychische Widerstandsfähigkeit stark individuell geprägt sei. Widerstandsfähigkeit habe insbesondere etwas mit Charaktereigenschaften zu tun. Der US-amerikanische Psychologe George Bonanno vertritt dagegen die Ansicht, dass Resilienz eher von Umwelteinflüssen und sozialen Faktoren abhängig sei. Wer etwa Trauer zu verarbeiten hat, kommt besser aus der Krise, wenn er sich auf sein soziales Umfeld verlassen kann. Die Rede von starken Einzelpersonen und individuell besonders ausgeprägter Widerstandsfähigkeit könnte man gar, überspitzt formuliert und noch einen Schritt weiter gedacht, für ein neues Märchen aus der modernen Gesundheits- und Arbeitswelt halten: Wenn Du es nicht schaffst, dann liegt es halt an Dir! Was lässt sich zu diesen Zusammenhängen sagen?
Tatsächlich haben Resilienzforscher über lange Zeit gedacht, die Menschheit lasse sich in resiliente und weniger resiliente Menschen teilen – und dies habe vor allem etwas mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun. Als Wissenschaftler erstmals ihren Blick für die psychische Stärke mancher Menschen in Krisensituationen schärften, dachten sie, dies sei deren Persönlichkeitseigenschaft, die in allen Situationen gelte und durch nichts zu erschüttern sei. Sie sprachen sogar von den “Invulnerablen”, den Unverwundbaren. Erst mit der Zeit wurde der Blick auf die psychische Widerstandskraft differenzierter. Kaum ein Forscher hält Resilienz heute noch für ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Charaktereigenschaft.
Durch die Forschung der vergangenen Jahrzehnte ist mehr als deutlich geworden, dass Resilienz keine immerwährende und zu jeder Zeit gültige Eigenschaft eines Menschen ist. Vielmehr gibt es für jeden von uns Situationen, in denen wir stärker sein können, und andere Situationen, in denen wir besonders verletzlich sind. Der eine Mensch kommt vielleicht mit beruflichen Krisen oder Stress ganz gut zurecht, ist aber in Beziehungsfragen sehr empfindlich. Der andere Mensch mag eine Ehescheidung gut verkraften, nicht aber die Diagnose einer schweren Krankheit. Und der dritte kommt über den Verlust der Heimat gut hinweg, verliert dann aber plötzlich nach einem schweren Verkehrsunfall das Vertrauen ins Leben.
Auch verändert sich die Empfindsamkeit der Seele im Laufe des Lebens. Wie stark ein Mensch psychisch gerade ist, hängt außer von der Situation von zahlreichen weiteren Faktoren ab, die zum Teil Veranlagung sind und in den Genen liegen, zum Teil aber auch aus der Erziehung und Fürsorge entstehen. Auch das soziale Netz, das George Bonanno anspricht, ist ein wesentlicher Resilienzfaktor.
Bei all diesen Faktoren lässt sich der Einfluss von Umwelt und Genen aber nicht so einfach trennen, wie es zunächst den Anschein hat. Denn ob ich ein gut funktionierendes soziales Netz habe, hängt schließlich auch erheblich von meinen Charaktereigenschaften ab. Genetische, neurobiologische, psychologische und soziale Faktoren greifen beim Thema Resilienz in erheblichem Maße ineinander. Dabei prägt nicht nur die Umwelt, die schon mit einem liebevollen Elternhaus beginnt, unseren Charakter und unsere psychische Stärke. Umgekehrt prägen wir mit unserer Stärke und unserem Charakter auch unsere Umwelt: Wer besonders resilient ist, sucht sich ein Umfeld, das ihm gut tut. Er gestaltet seine Welt eher nach seinen Wünschen und Bedürfnissen als ein Mensch mit weniger psychischer Stärke. Ein aufgeschlossener Mensch hat gemeinhin ein stärkeres soziales Netz.
Dass Resilienz letztlich so variabel ist, bedeutet einen großen Vorteil: Man kann an ihr arbeiten und ein Leben lang an Stärke zulegen. Dass mancher Arbeitgeber dies in seinem Sinne interpretiert und meint, wenn seine Angestellten reihenweise einen Burnout erleiden, dann liege das an ihnen, ist gewiss eine Gefahr des modernen Resilienzbegriffs. Es lässt sich sicher nicht wegdiskutieren, dass manche Menschen großen Stress und schlechte Arbeitsbedingungen besser wegstecken als andere, aber dies nimmt den Arbeitgeber sicher nicht aus der Verantwortung, gute Bedingungen für seine Mitarbeiter zu schaffen, deren psychischer und körperlicher Gesundheit er verpflichtet ist.

Für manche Tiere mag es seltsam erscheinen, wenn Menschen vor lauter Problemen ständig ihre Umwelt vergessen. In solchen Situationen wird beispielsweise viel gejammert und der Ich-Stress verstärkt.
Sie selbst haben ein sehr erfolgreiches populärwissenschaftliches Buch mit dem Titel “Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft” publiziert, in dem Sie als Wissenschaftsjournalistin verschiedene Forschungsergebnisse aus Neurobiologie, Genetik und Psychologie kompakt zusammengefasst und anschaulich vermittelt haben. Können Sie anhand dieser verschiedenen Forschungsrichtungen einmal grob umreißen, wo aktuell die Trends und Entwicklungen in der Resilienz-Forschung liegen?
Das Faszinierende an der modernen Resilienzforschung ist vor allem ihr differenzierter Blick auf die Wechselwirkung von Genen und Umwelt, der in der Antwort auf Ihre erste Frage schon angeklungen ist. Als sich die Humangenetik in den 1980er-Jahren entwickelte, waren die meisten Naturwissenschaftler so fasziniert davon, dass sie dachten, das Schicksal eines Menschen liege vor allem in seinen Genen begründet. Die Geistes- und Sozialwissenschaftler aber haben sich sehr gegen diese Sicht gewehrt und weiterhin den Einfluss von Pädagogik und Psychologie auf das Wesen des Menschen hochgehalten. Heute weiß man: Beide haben Recht. Gene und Umwelt teilen sich den Einfluss in etwa zu gleichen Teilen.
Wie komplex die Wechselwirkungen von Genen und Umwelt sind, bringen Resilienzforscher zunehmend in Erfahrung. Das sehr neue Forschungsgebiet der Epigenetik bringt hier faszinierende Erkenntnisse. Es zeigt nämlich, dass Gene keineswegs unveränderlich sind. Vielmehr verändern sie sich im Laufe des Lebens – eben durch die Art, wie wir leben und durch das, was wir erleben. Gene sind ja nichts anderes als Moleküle. Sie können sich auch molekular verändern. Und alles, was wir essen, die Freuden und das Leid, die uns mit der Zeit widerfahren, kann kleine (epigenetische) Veränderungen an unseren Genen mit sich bringen. So haben Wissenschaftler festgestellt, dass sich erlebte Traumata in der Kindheit auf diese Weise tief ins Erbgut eingraben. Solche Kinder sind ihr Leben lang besonders vulnerabel, wenn ihnen wieder Schreckliches widerfährt.
Die Epigenetik zeigt also, dass dem Menschen zwar seine Erbanlagen mitgegeben sind. Aber letztlich bilden sie nur die Bühne, auf der er tanzen kann. Er hat immer noch genügend Gestaltungsmöglichkeiten, die Erziehung und seine soziale Umwelt prägen ihn, sodass sich eventuell vorhandene “schlechte” Gene gar nicht so sehr auswirken.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch von der Suche nach dem Resilienz-Gen. Sie nennen als Beispiel das Gen 5-HTT. Was ist das für ein Gen, übersetzt für Laien? Und wieso ist die Forschung zu diesem Gen so relevant für das Thema Resilienz?
5-HTT ist ein Beispiel dafür, dass es tatsächlich “schlechte” und “gute” Gene in Bezug auf die Resilienz gibt – zumindest auf den ersten Blick. Das haben vor einigen Jahren die US-Amerikanerin Terrie Moffitt und ihr israelischer Partner Avshalom Caspi als erste entdeckt. Sie durften die Gene von mehr als 1000 Kindern aus Neuseeland untersuchen, die schon seit den 1970er-Jahren an einer Studie teilnahmen und über deren Schicksal viel bekannt war. So zeigte sich, dass 5-HTT einen faszinierenden Einfluss darauf hatte, wie diese Kinder mit Schicksalsschlägen umgehen – ob sie danach krank wurden oder sie gut verkrafteten.
5-HTT hat eine wichtige Aufgabe im Gehirn: Es reguliert das Vorhandensein des Hirnbotenstoffs Serotonin. Dieser wird nicht umsonst gern als “Glückshormon” bezeichnet. Denn Serotonin macht euphorisch, vertreibt Ängste und hemmt Aggressionen. Vom 5-HTT-Gen aber gibt es zwei verschiedene Formen, eine kürzere und eine längere. Und bei der längeren Form scheint es sich tatsächlich um ein Resilienz-Gen zu handeln. Denn die Kinder aus Neuseeland, die über diese Gen-Variante verfügten, erwiesen sich als weniger verletzlich als die Kinder mit der kürzeren Gen-Variante. Wenn in ihrem Leben etwas Schlimmes passierte, neigten sie weniger zu Depressionen. Sie schienen seelisch stabiler zu sein. Inzwischen sind noch weitere Gene gefunden worden, die offenbar eine ähnliche Rolle bei der Ausprägung von Resilienz spielen wie 5-HTT.

Tiere haben mit solchen Problemen eher weniger am Hut. Nur manchmal gewinnt man etwa bei Hauskatzen den Eindruck, dass sie ein ähnlich obskures Verhalten wie Menschen an den Tag legen.
Bei Genen denkt man ja als Laie recht häufig an Unveränderbarkeit der eigenen Erbanlagen. Auf den Umgang mit Stress bezogen, würde das bedeuten: Manche Menschen sind einfach von Natur aus nicht belastbar. Nun schreiben Sie aber bemerkenswerterweise, dass eben auch unsere Gene formbar und gar nicht so vorprogrammiert seien, wie man das lange in der Forschung angenommen hat. Können Sie diesen Gedanken einmal näher ausführen, am besten anhand eines konkreten Beispiels?
Das Beispiel 5-HTT eignet sich auch hier sehr gut: Schon bei diesem ersten je entdeckten Resilienz-Gen zeigte sich nämlich, dass sich die “schlechte” Form – also jene, die eher anfällig für Stress macht – nur dann negativ auswirkte, wenn die Kinder in ihrem jungen Leben Schicksalsschläge erleiden mussten. Wenn also ein Elternteil starb oder sie Gewalt erfuhren. Geschah dies nicht, schien ihr 5-HTT-Gen keine große Rolle in ihrer Entwicklung zu spielen. Ein Trübsinns-Gen allein macht einen Menschen also noch lange nicht trübsinnig, da muss einiges hinzukommen.
Und, auch das sind sehr faszinierende neue Erkenntnisse: Die Gene, die auf den ersten Blick schlecht für die Resilienz zu sein scheinen, können sogar durchaus förderlich sein. Das gilt auch für weitere Gene, die zum Beispiel das Risiko für das Zappelphilippsyndrom ADHS erhöhen oder die Gewaltbereitschaft zu steigern scheinen. Wenn Kinder mit solchen Genen in einer besonders liebevollen Umwelt aufwachsen und besonders gefördert werden, dann entwickeln sie sich oft besonders gut: Sie haben mehr Freunde als andere Kinder, kommen in der Schule besser klar und nehmen auch seltener Drogen.
Woran das liegen könnte? Wahrscheinlich machen diese Gene sensibel. Nicht nur sensibel für Krankheiten, Aggressionen und Stress. Die Kinder scheinen auch besonders empfänglich für liebevolle Zuwendung zu sein. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von “Orchideen-Kindern” und von “Löwenzahn-Kindern”. Der Löwenzahn ist zwar eine widerstandsfähige Pflanze, die notfalls auch auf dem Schrottplatz des Lebens gedeiht und dort sogar blüht. Das gelingt der Orchidee nicht. Aber wenn die Orchidee gut gepflegt wird, dann treibt sie die schöneren Blüten.

Vielleicht sind ja auch die wirklich angepassten Tiere die eigentlich relaxten. Dann hätte sich zumindest ein Teil des Geheimnisses der psychischen Widerstandskraft von ganz alleine erledigt. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen von wilden Tieren wie Leoparden noch etwas lernen können …
Auch bei dem Thema Demenz wird aktuell in der Forschung darüber diskutiert, inwieweit eine spezifische Demenzform wie Alzheimer auf genetische Grundlagen zurückgeführt werden kann. In der Zukunft werden wir wahrscheinlich immer häufiger und vor allem immer früher Prognosen über Krankheiten wie Alzheimer anstellen, die so gar nicht eintreten müssen, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten durch genauere Diagnostik zunehmend höher ausfallen. Denkbar ist beispielsweise die Frühdiagnose bei Kindern, denen beim Kinderarztbesuch ein gewisses Alzheimer-Risiko nachgesagt wird. Wie lautet Ihre persönliche Meinung dazu?
Frühe Diagnosen sind immer dann schwierig, wenn die Diagnose nur Angst macht, aber nicht helfen kann. Das ist der Fall, wenn man schon Kindern sagt, dass sie später mit hoher Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranken werden. Der Blick ins Erbgut kann Erleichterung bieten, aber er kann einen Menschen eben auch ein Leben lang mit Sorge erfüllen. Deshalb muss jeder Mensch selbst entscheiden dürfen, wie tief er in sein Erbgut blicken will. Im Fall von Kindern ist diese eigene Entscheidungsfähigkeit nicht gegeben. Deshalb ist hier eine Diagnose einer unheilbaren Krankheit in meinen Augen unmoralisch und unseriös.
Etwas anderes ist es, wenn es sich um behandelbare Krankheiten handelt. Die meisten Neugeborenen werden heute schon bald nach der Geburt im Rahmen des “Neugeborenenscreenings” auf mehrere Stoffwechselkrankheiten und Hormonstörungen untersucht. Das findet allerdings zunächst nicht mit Hilfe von Gentests statt. Diese Tests sind sehr sinnvoll, denn man kann den Kindern helfen, wenn man um ihre Veranlagung weiß. Vielleicht wird eines Tages auch das frühe Wissen um eine Alzheimerdiagnose sinnvoll sein – wenn eine Prophylaxe möglich wäre. Dann müsste man sich die Vor- und Nachteile einer solchen Prophylaxe noch einmal genauer ansehen. Vielleicht kämen wir dann zu dem Schluss, dass ein Gentest auf Alzheimer schon im Babyalter hilfreich ist.
Frau Berndt, vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Marcus Klug. Das Buch “Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burn-out” von Christina Berndt ist im Jahre 2013 bei dtv premium erschienen und ist gerade auch für Entscheider und professionelle Pflegekräfte sehr zu empfehlen, bietet es doch einen sehr guten Überblick zu aktuellen Forschungsergebnissen aus der Forschung zu den Wirkungsprinzipien der psychischen Widerstandskraft: von Psychologie, Soziologie und Pädagogik bis hin zu Biologie, Medizin und Epigenetik. Außerdem enthält das klar und verständlich geschriebene Buch einige Selbsttests, Tabellen und Auflistungen, etwa ein außergewöhnlich ausführliches Literaturverzeichnis und Glossar. Hier der Link zum Buch.
Quellenangaben zu den Fotos:
Foto: Chris Glass / www.flickr.com
Foto: Hartwig HKD / www.flickr.com
Foto: Catalin Munteanu / www.flickr.com
Foto: cloudtail / www.flickr.com
Dr. Christina Berndt ist Redakteurin im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung. Dort beschäftigt sie sich vor allem mit Lebenswissenschaften und Medizin. Zuvor studierte sie Biochemie an den Universitäten Hannover und Witten/Herdecke. Für ihre Dissertation am Deutschen Krebsforschungszentrum erhielt sie den Promotionspreis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. 2006 erhielt sie den European Science Writers Junior Award. In diesem Jahr hat sie die Manipulationen bei Organtransplantationen in Göttingen und Regensburg enthüllt. Kontakt: christina.berndt@sueddeutsche.de.
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.