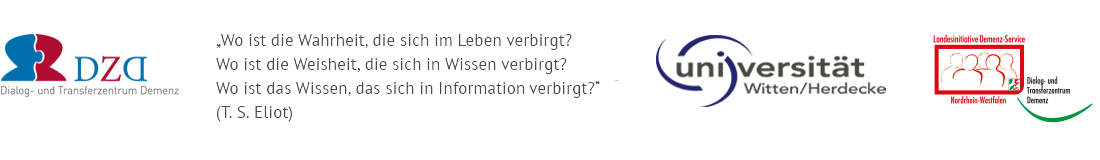Ein Alzheimer-Patient erzählt von seinem Alltag, eine Ministerin fragt: „Wie wollen wir leben?“ und der Schwerpunkt am 25. Februar: Herausforderndes Verhalten.
Ein Alzheimer-Patient erzählt von seinem Alltag, eine Ministerin fragt: „Wie wollen wir leben?“ und der Schwerpunkt am 25. Februar: Herausforderndes Verhalten.
Wissenschaft trifft auf Wirklichkeit – so könnte man den ungewöhnlichsten Teil der Tagung „Möglichkeiten und Grenzen psycho-sozialer Interventionen bei Demenz“, die am 25. Februar 2015 vom Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) an der Universität Witten/Herdecke ausgetragen wurde, beschreiben: Detlef Rüsing – Leiter des DZD – interviewte Kerstin Thörmer (50) und Joachim Boes (61), die als Paar jeden Tag mit der Diagnose Demenz leben. Der 61-Jährige ist an Alzheimer erkrankt. Seit sieben Jahren arbeitet der ehemalige Verkaufsleiter eines Tabakunternehmens, der seinen Beruf so liebte, nicht mehr. Er spielte viele Instrumente, machte gar einen Flugschein. Er sprach an diesem Tag ruhig ins Mikro, nur manchmal fehlten ihm die Worte,
Es ist dieses Szenarium, das auch NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens in ihrem Vortrag „Wie wollen wir im Alter (mit Demenz) leben?“ betonte: der Wunsch danach, so lange wie es nur geht, in den eigenen vier Wänden zu leben, auch wenn die Diagnose Alzheimer lautet. Boes erzählte weiter, wie er jeden Tag in der nächsten Umgebung spazieren geht, wenn sein Frau auf der Arbeit ist. Und wie fest verankerte Rituale für Halt im Alltag sorgen, so wie etwa der Gang zur nächstgelegenen Metzgerei, den er regelmäßig zu einem festen Zeitpunkt wiederholt. Dafür braucht man Nachbarn und Personen in der nächsten Umgebung, die auf Menschen wie Boes eingestellt sind. „Quartiersnahe Versorgung“ ist hier das Stichwort, wie auch NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens später bestätigte. „Wie möchten Sie denn alle alt werden und wo?“, fragt sie in ihrem Vortrag „Wie wollen wir im Alter (mit Demenz) leben?“. „Wir sind alle froh, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben, und möchten gerne, dieses Mehr an Lebensjahren, was wir gewonnen haben, mit einer guten Lebensqualität leben, und zwar da, wo wir immer gelebt haben.“
Für die israelische Demenzforscherin Prof. Jiska-Cohen Mansfield (Department of Health Promotion School of Public Health, Tel Aviv University) ist die Bewahrung oder Verbesserung der Lebensqualität in der Versorgung von Menschen mit Demenz ebenso ein zentrales Anliegen. Sie hat zusammen mit ihrem Team in zahlreichen internationalen Studien erforscht, inwieweit Interventionen bei Menschen mit Demenz zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können, selbst wenn herausfordernde Verhaltensweisen wie Apathie, Aggression und Rufen dominieren.
In ihrem Vortrag „Living with challeging behaviour – Research serving practise“ (zu Deutsch: „Leben mit herausforderndem Verhalten – Forschung im Dienste der Praxis“) präsentierte sie zunächst einzelne Videos, in denen gezeigt wurde, wie man sich herausfordernde Verhaltensweisen in der Praxis vorzustellen hat. Man sah ältere Frauen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen umherwandern, die kaum sprechen, dann aber zunächst unerklärlich laut und aggressiv werden. In solchen Fällen probierten Cohen-Mansfield und ihr Forschungsteam verschiedene Interventionsmöglichkeit aus: Pflegende, die besonders langsam und betont sprechen, Pflegende, die zusammen mit den Betroffenen singen, oder Pflegende, die zum Spielen animieren. Zuweilen führten diese Interventionen dazu, wie Cohen-Mansfield berichtete, dass einzelne Personen, die ganz verstummt waren, wieder sprachen.
 Bei der Tagung des DZD ging es bis zum Ende um herausfordernde Verhaltensweisen. Der Pflegewissenschaftler Georg Franken (DZD) gab einen Überblick zum Thema. Silvia Herb (Fachkraft Gerontopsychiatrie, Das Pflegeteam, Emmendingen) stellte gegen Ende der Tagung einen Fall aus einer ambulanten Wohngemeinschaft vor, der in der Praxis nicht einfach zu lösen war: Ein älterer Herr, der an Demenz erkrankt war und der über einen militärischen Hintergrund verfügte, wollte sich so gut wie gar nichts von den Pflegenden sagen lassen und reagierte häufig ziemlich aggressiv. Der Mann kam schließlich nach mehreren tätlichen Angriffen mit einem Messer in die Psychiatrie.
Bei der Tagung des DZD ging es bis zum Ende um herausfordernde Verhaltensweisen. Der Pflegewissenschaftler Georg Franken (DZD) gab einen Überblick zum Thema. Silvia Herb (Fachkraft Gerontopsychiatrie, Das Pflegeteam, Emmendingen) stellte gegen Ende der Tagung einen Fall aus einer ambulanten Wohngemeinschaft vor, der in der Praxis nicht einfach zu lösen war: Ein älterer Herr, der an Demenz erkrankt war und der über einen militärischen Hintergrund verfügte, wollte sich so gut wie gar nichts von den Pflegenden sagen lassen und reagierte häufig ziemlich aggressiv. Der Mann kam schließlich nach mehreren tätlichen Angriffen mit einem Messer in die Psychiatrie.
In der offenen Fallbesprechung am Nachmittag ging es um einen Mann, der alkoholabhängig war und von dem man nicht genau wusste, ob er tatsächlich Alzheimer oder ein Korsakow-Syndrom hatte: Johannes van Dijk (Fachreferent für DCM und Gerontopsychiatrie, Frank Wagner Holding Hamburg) stellt ihn als Fallbringer, den Moderator Christian Müller-Hergl (Pflegewissenschaftler, DZD), Sandra Eisenberg (Das rauhe Haus, Evangelische Berufsschule für Pflege Hamburg), Ursula Fischer (Fachkraft für Gerontopsychiatrie, Sophie Cammann-Haus St. Johannisstift Paderborn), Jörg Killinger (Psychobiologe, Gründer Beraternetzwerk Killinger Networking Berlin) und Dr. Klaus Maria Perrar (Facharzt für Psychiatrie, Köln), vor. Das Problem bestand zudem darin, dass seine Frau sich von dem Mann trennen wollte, sich aber nicht traute, offen über dieses Problem zu reden, was die Pflege nicht gerade einfacher gestaltete. Denn die professionell Pflegenden hatten der Frau versprochen, ihr Beziehungsproblem gegenüber ihrem Ehemann nicht offen anzusprechen. Erst am Ende konnte man sich dann doch noch dazu durchringen, dem Ehemann die Wahrheit zu sagen.
Quellenagabe zu den Fotos:
Fotos: Jürgen Appelhans