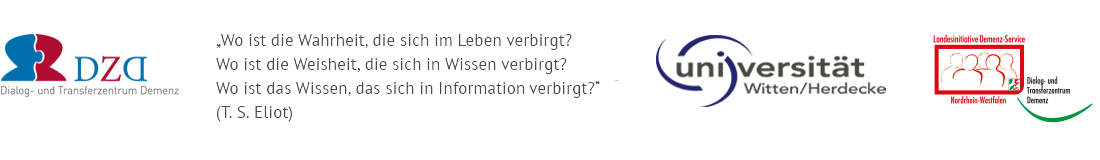In den verschiedensten Ausprägungen der Depression sorgen Kranke unbewusst dafür, dass das Gegenüber ihr Verhalten spiegelt. In diesem Beitrag reflektiert der Demenzexperte Christian Müller-Hergl darüber, warum Zuwendung ohne Distanz im professionellen Umgang mit Depressiven nicht möglich ist.
In den verschiedensten Ausprägungen der Depression sorgen Kranke unbewusst dafür, dass das Gegenüber ihr Verhalten spiegelt. In diesem Beitrag reflektiert der Demenzexperte Christian Müller-Hergl darüber, warum Zuwendung ohne Distanz im professionellen Umgang mit Depressiven nicht möglich ist.
In den verschiedensten Ausprägungen der Depression können Pflegende häufiger in Situationen geraten, in denen Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, unbewusst dafür sorgen, dass das Gegenüber ihr Verhalten spiegelt. So appelliert beispielsweise eine depressive Person zum Beispiel mit Leidensdruck an das Mitgefühl des Gegenübers. Als Reaktion darauf verstärkt dieses die Zuwendung und versucht gleichzeitig, den depressiven Menschen zu schonen. Damit ist der Pflegende schon in depressiogene Beziehungskreisläufe eingebunden: was immer er tun wird, es wird nicht reichen, nicht passen, nicht zufrieden stellen. Auch verstärkte Bemühungen zeigen keinen Erfolg. Der Pflegende mag sich manipuliert und missbraucht vorkommen, will seine aufkommenden aggressiven Gefühle von Manipulation und Ausnutzung dem anderen nicht zeigen, da dieser ja krank ist. Eben damit beginnt er, die depressive Struktur in sich ab- und auszubilden, z. B. mit der Vorstellung, eben nicht zu genügen.
“Die Arbeit mit depressiven Menschen ist eine der härtesten, schwierigsten Aufgaben, die man als Pflegender leisten kann.” – Christian Müller-Hergl
Auch auf die Unzufriedenheit sowie die zahlreichen Vorwürfe und Anklagen reagiert der Pflegende mitunter verteidigend und ärgerlich, was aber wieder zurückgenommen wird, weil der andere ja krank ist. Aus dem Ärger entsteht dann unter Umständen ein aggressiver Unterton. Die Situation endet damit, dass man mit seinem eigenen Hin und Her zwischen Grenzsetzung und Einfühlung nicht klarkommt. Damit spiegelt man aber genau die ambivalente Situation des depressiven Menschen wider, der auch jede Form von Nähe und Hilfe als Kränkung und Schädigung begreifen und abwehren muss.
Das Desinteresse und die Gefühlsarmut bringen die Pflegenden in der Regel erst einmal dazu, sich noch mehr zu bemühen. Aber wenn alle Bemühungen nichts fruchten, resigniert man und lässt den anderen doch lieber wieder alleine. Auch damit spiegelt man die Reaktionsmuster des anderen, der auch nicht mehr wollen kann. Man spricht hier von der so genannten “depressiven Prophezeiung”: “Ich bemühe mich immer wieder, ich gehe immer wieder hin, aber der macht ja nicht mit.” Ähnliche Gedanken hat ja auch der depressive Mensch, denn er ist nicht selbständig in der Lage, aus seiner antriebslosen Situation herauszukommen, egal, was er tut. Für die Pflegenden bedeutet das, in ein stetiges Wechselbad von Hoffnung und Resignation zu geraten. Ähnlich wie der Kranke werden sie auf Dauer emotional zutiefst erschöpft.
Die Arbeit mit depressiven Menschen ist eine der härtesten, schwierigsten Aufgaben, die man als Pflegender leisten kann. Aber wie können Pflegende diese Aufgabe meistern? Worauf sollten Pflegende im besonderen Maße achten?
Warum Zuwendung ohne Distanz nicht möglich ist
Die Aufgabe der Pflegenden ist es jetzt, diese dynamischen Strukturen wahrzunehmen und sie nicht unreflektiert zu bedienen. Dafür müssen sie sich aber selbst genau beobachten, denn ihre eigene innere Verfassung in Bezug auf die Person mit Depression ist eine Möglichkeit, die Situation ihres Gegenübers zu bilanzieren, z. B. das Gefühl, den Kontakt vermeiden zu wollen (Fluchtpflege) oder das Gefühl, nicht helfen zu können. Und wenn man versteht, was sich vom anderen bei einem selbst überträgt, kann man vermuten, in welcher Verfassung sich die Person mit Depression befindet (die Person findet sich auch nicht attraktiv, ist überfordert, hilflos).
Man gewinnt eine Vorstellung davon, was tunlichst zu vermeiden ist und welche Möglichkeiten förderlich sein könnten (z. B. den Kontakt nicht zu vermeiden, eine freundlich gelassene Zuwendung aufrecht erhalten oder auf die eigenen Grenzen zu achten und sich beizeiten kontrolliert zurückziehen). Das ist recht anspruchsvoll und setzt eine angemessene Distanz zur Situation und zum Patienten voraus. Die Minimalbedingung lautet hier: Du darfst die Affekte deines Gegenübers nicht übernehmen.
In der Arbeit mit depressiven Menschen brauchen Pflegende diese Distanz, aus der heraus die Zuwendung erfolgt. Distanz bedeutet in diesem Fall, dass Pflegende sich in der Beziehungsarbeit beobachten und darauf achten, nicht in den depressiven Sog zu geraten. Denn das Schlimmste, was einem depressiven Menschen passieren kann, ist ein depressives Gegenüber, dass ihn oder sie in der selbstbezogenen Negativität und der depressiven Prophezeiung bestärkt.
Pflegende sollten im Kontakt eine gute Balance zwischen Autonomie und Anerkennung anbieten, eine Struktur wie ein Modell, von dem sich die Person mit Depression interaktiv und dynamisch etwas `ausleihen´ kann. Der Pflegende fordert und traut der Person etwas zu, vermittelt aber zugleich das Gefühl, gewollt und akzeptiert zu werden – auch dann, wenn die Anforderung nicht gelingt. Es kommt dabei darauf an, den indirekten depressiogenen Angeboten in der Beziehung standzuhalten, zum Beispiel der Vorstellung, dass ja nichts helfen kann, insbesondere der Pflegende nicht.
Dieser Abwertung seiner selbst und des Pflegenden gilt es stand zu halten, indem immer wieder Möglichkeiten aufgezeigt und eingefordert werden, gemeinsame Tätigkeiten für wünschenswert und machbar vorgestellt werden, ermutigt wird, ohne sich beim Scheitern dieser Bemühungen sichtbar enttäuscht zurückzuziehen. Das gelingt am besten, wenn man ein Stück weit die Tatsache der Depression akzeptiert: “Sie haben eine Depression, das ist nicht meine Schuld und ich kann es auch nicht ungeschehen machen. Ich akzeptiere es, dass die Depression im Moment zu Ihrem Leben gehört.” Gleichzeitig erkennt man aber auch das damit verbundene Leiden an, indem man zum Beispiel (nicht leidend!) sagt: “Ich spüre, wie belastend und schwer das heute für Sie ist.” Die indirekte Botschaft dabei ist: “Ich sehe, Sie sind bedrückt, und spüre es auch, aber ich bin es nicht.” Wenn man lernt, das Gefühl nicht für sich zu übernehmen, kann man sich auch davon distanzieren.
Stellvertretende Hoffnung
 Grundsätzlich brauchen Pflegende eine positive Haltung gegenüber dem Klienten, die immer wieder bewusst hergestellt werden muss. Teilen Pflegende das negatives Bild, das der Klient von sich hat – “Das bringt ja eh nichts” – dann tappen sie in die depressive Falle, entwerten die Bedeutung ihrer Arbeit und ziehen sich im schlimmsten Fall zurück. Aus der Forschung ist bekannt: je weniger Pflegende glauben, dass ihre Interaktionen einen Effekt haben, desto geringer ist das Wohlbefinden der Klienten. Ihre Reaktionen müssen Pflegende bewusst reflektieren, um dagegen zu steuern, indem sie sich sagen: “Ich gehe da jetzt bewusst hin, mache mir die positiven Möglichkeiten bewusst, biete davon etwas an in der Annahme, dass dies sinnvoll ist. Der Patient mag dies wieder ablehnen, aber ich wiederhole das Angebot.” Lehnt er es ab, wiederholt der Pflegende sein Angebot mit milder Beharrlichkeit. Und erneut und immer wieder: “Wie bedrückend das heute für Sie ist, das sehe ich. Ich bin aber für Sie da, ich komme in einer halben Stunde noch mal wieder.”
Grundsätzlich brauchen Pflegende eine positive Haltung gegenüber dem Klienten, die immer wieder bewusst hergestellt werden muss. Teilen Pflegende das negatives Bild, das der Klient von sich hat – “Das bringt ja eh nichts” – dann tappen sie in die depressive Falle, entwerten die Bedeutung ihrer Arbeit und ziehen sich im schlimmsten Fall zurück. Aus der Forschung ist bekannt: je weniger Pflegende glauben, dass ihre Interaktionen einen Effekt haben, desto geringer ist das Wohlbefinden der Klienten. Ihre Reaktionen müssen Pflegende bewusst reflektieren, um dagegen zu steuern, indem sie sich sagen: “Ich gehe da jetzt bewusst hin, mache mir die positiven Möglichkeiten bewusst, biete davon etwas an in der Annahme, dass dies sinnvoll ist. Der Patient mag dies wieder ablehnen, aber ich wiederhole das Angebot.” Lehnt er es ab, wiederholt der Pflegende sein Angebot mit milder Beharrlichkeit. Und erneut und immer wieder: “Wie bedrückend das heute für Sie ist, das sehe ich. Ich bin aber für Sie da, ich komme in einer halben Stunde noch mal wieder.”
Dabei bleibt der Pflegende stets zugewandt, freundlich, nicht übertrieben höflich, distanziert aber nicht kalt und lässt sich in dieser Haltung nicht irritieren. Ein anderer Begriff dafür ist die “stellvertretende Hoffnung”: Pflegende bemerken, dass der Klient zurzeit keine Hoffnung oder Perspektive für sich entwickeln kann, so dass sie dies stellvertretend für ihn übernehmen. Pflegende nehmen eine Art Assistenzfunktion, die Rolle eines Hilfs-Ichs ein, indem sie das für den Klienten versuchen, was dieser ohne seine depressive Verfassung vermutlich täte. Sie kompensieren einen Strukturverlust und bieten dem Klienten sich selbst in der Beziehung als Strukturersatz an: “Sie selbst können im Moment nicht wollen und haben keine Kraft dazu, aber mit mir zusammen können sie das bewältigen und sich glaube daran, dass es Ihnen gut tun wird.” Sie bringen ihm diese positive Haltung beständig und verlässlich entgegen. Sie halten damit eine Möglichkeit der Beziehung offen, die der Kranke in seinem häuslichen Umfeld unter Umständen nicht kennt: dass es Menschen gibt, die der Depressivität standhalten können und nicht aus der Beziehung fliehen. Mit dieser Beziehung geht auch das Offenhalten der Möglichkeit einher, ohne Depression zu leben.
Im Fokus stehen die positiven Anteile der Depression
In der direkten Kommunikation greift man die depressiogenen Anteile eines Klienten eher weniger auf, sondern konzentriert sich auf die positiven Anteile in einer Situation und tritt der Depression damit entgehen, zum Beispiel: “Ich kann durchaus wahrnehmen, dass Sie jetzt glauben, das ist ja gar nichts, dass Sie alleine zur Therapie gegangen sind. Aber ich finde, im Vergleich zu vorgestern ist das doch schon mal was.” “Ach, hören Sie doch bloß auf!” “Ja, aber ich möchte das dennoch festhalten.” Damit lässt sich der Pflegende von der depressiogenen Selbstwahrnehmung nicht beeindrucken und hält an den positiven Möglichkeiten fest, auch wenn der Depressive das abwehrt bzw. den Pflegenden und seine Assistenz entwertet.
“Grundsätzlich brauchen Pflegende eine positive Haltung gegenüber dem Klienten, die immer wieder bewusst hergestellt werden muss. Teilen Pflegende das negatives Bild, das der Klient von sich hat – `Das bringt ja eh nichts´ – dann tappen sie in die depressive Falle.” – Christian Müller-Hergl
Das sind – etwas flapsig formuliert – die Regeln des Spiels. Wenn der Pflegende hier an seine Grenzen stößt und spürt, wie sich die Macht des Depressiven seiner bemächtigt, dann geht er wenn möglich rechtzeitig aus der Situation heraus, zum Beispiel zu einem Patienten, bei dem sich der Pflegende im Kontakt wieder aufbauen kann. Da die innere Haltung oft durch die eigene Körperlichkeit gesteuert wird, könnte der Pflegende auch andere selbstpflegebezogene Dinge tun, um sich wieder aufzurichten. Kein Mittel scheint hier so gut zu wirken wie Humor.
Die Pflegenden als antidepressives Gegenüber
Die Begegnung erfolgt zuverlässig und klar strukturiert. Wichtig ist dabei die Vorbereitung des Pflegenden auf den Kontakt, auch in Bezug auf sich selbst. Der Kontakt bleibt unauffällig, aber deutlich spürbar, ohne dass gegenüber der Person ein hoher Druck aufgebaut wird. Der Pflegende ist präsent, als Person mit einem Anliegen und einem Interesse (zum Beispiel Ernährung oder Körperpflege). Er ist aber durchaus in der Lage, sich zurückzuziehen und zurückzunehmen. Er lässt sich nicht auf Machtkämpfe ein und bemisst den Erfolg seiner Arbeit nicht daran, dass die Person mit Depression heute mitmacht.
Erfolg haben Pflegende dann, wenn die Machtkämpfe vermieden werden, der Rückzug rechtzeitig gelingt und der Zuspruch an positiven Möglichkeiten trotz des Widerstandes aufrechterhalten werden kann. Oder wenn es gelingt, trotz Widerstand und Ablehnung tröstlich zu sein und damit ein Gegengewicht zur Selbstverurteilung des Patienten erkennbar wird. Und wenn die Pflegenden trotz vordergründigem `Scheitern´ in der Lage sind, sich anschließend einen guten Kontakt zu gönnen, sich herzlich zu freuen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Diese Haltung bleibt auch dann erhalten, wenn der Sog stärker wird. Es bedarf der Zeit, der Ruhe, Geduld, Gelassenheit und Souveränität.
Ein Überengagement im Sinne von “Den hole ich raus aus seiner Depressivität” ist nicht angebracht, weil man sich damit nur zu schnell wieder in den depressiven Sog begibt. Denn es gibt ja auch noch Ärzte, Therapeuten und Medikamente, die gegen die Depression angehen. Die Pflegenden bleiben ein “antidepressives Gegenüber”, das ist das hilfreichste, was sie tun können.
Quellenangabe zu den Fotos:
Foto: Christian Weidinger / www.flickr.com
Foto: EL@_56 / www.flickr.com
Christian Müller-Hergl ist Philosoph und Theologe. Er arbeitet u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Dialog- und Transferzentrum an der Universität Witten-Herdecke. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Themen Demenz und Gerontopsychiatrie. Er ist zudem strategischer Leiter und Trainer für Dementia Care Mapping-Verfahren, eine ursprünglich von Tom Kitwood und Kathleen Bredin in England entwickeltes personenzentriertes Evaluations- und Beobachtungsverfahren. Kontakt: Christian.Mueller-Hergl@uni-wh.de.
————–
Lesetipps zum Thema Depression:
- Ehrenberg, A (2008): Das erschöpfte Selbst: Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Suhrkamp.
- Grabenstedt Y., Völkl G., Banck G., Will H. (2008). Depression: Psychodynamik und Therapie, Kohlhammer.
- Kandel, ER (2008): Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes, Suhrkamp.
- Kipp, J; Unger, H-P; Wehmeier, PM (1996): Beziehung und Psychose: Leitfaden für den verstehenden Umgang mit schizophrenen und depressiven Patienten, Thieme.
- Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, (2005), Sonderheft 59 (9/10). Depression: Psychoanalytische Erkundungen einer Zeitkrankheit.
- Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, (2010), Sonderheft 64 (9/10). Depression: Neue psychoanalytische Erkundungen einer Zeitkrankheit.
- Rass, E (2012): Allan Schore: Schaltstellen der Entwicklung. Eine Einführung in die Theorie der Affektregulation mit seinen zentralen Texten, Klett-Cotta.
- Schauenburg, H; Hofmann, B (Hsrg) (2007): Psychotherapie der Depression, Thieme.
- Schore, AN (2012): The Science of the Art of Psychotherapy, WW Norton & Company.
- Grabenstedt Y., Völkl G., Banck G., Will H. (2008). Depression: Psychodynamik und Therapie, Kohlhammer.