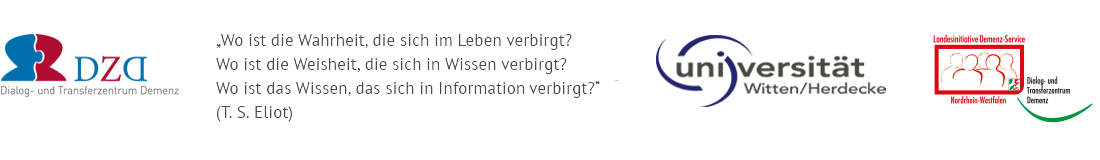Sinnvolle Beschäftigung übt nachgewiesenermaßen positive Effekte sowohl auf Menschen mit Demenz als auch auf Pflegende aus. Beschäftigung sollte demnach möglichst individuell angepasst sein. Aber wie lässt sich das bewerkstelligen, wenn Zeit und Ressourcen häufig knapp bemessen sind?
Die Bejahung des Personseins und nicht die Pathologie steht im personzentrierten Ansatz von Tom Kitwood im Vordergrund (Kitwood 2005). Pathologie lässt sich dabei leicht übersetzen: der Blick ist auf Probleme gelenkt, auf Defizite und Symptome, während der Ansatz von Kitwood für Ressourcen sensibilisiert. Wo ist der demente Mensch noch handlungsfähig? Wo könnte er in seinem Subjekt-Sein gefördert werden?
Vielleicht haben Sie in diesem Zusammenhang auch schon einmal von der Selbsterhaltungstherapie gehört. Die von Romero und Eder 1992 vorgestellte Selbsterhaltungstherapie (SET) wird als neuropsychologisches Trainingsverfahren angewendet. Im Kern geht es bei dieser Therapie darum, das Wissen um die eigene Person, ihrer Biografie und ihrer Besonderheiten, permanent zu fördern. Dieses Verfahren erinnert an Biografiearbeit: Auch diese Art von Arbeit will den Kern einer Person auf der Basis ihrer vergangenen Erfahrungen und Bedürfnisse herausstellen.
Sinnvolle Beschäftigung: eine Frage des Menschenbildes?
Worauf möchte ich hinaus? Idealtypisch fragen wir nicht danach, wie Beschäftigung in Organisationen und Institutionen prinzipiell aussieht, sondern wie sich Beschäftigung beispielsweise im Rahmen biografischen Arbeitens individuell gestalten lässt, wenn wir den Ansatz von Kitwood folgen. Welche Beschäftigung ist für welche Person mit Demenz sinnvoll? Eine idealtypische Konstellation.
Wie sieht es aber mit dieser Konstellation aus, wenn der Druck auf die Belegschaft größer wird, wenn personelle und zeitliche Ressourcen in der Versorgung relativ eng bemessen sind, wenn “personale Detraktionen” häufiger anzutreffen sind, um einen Begriff von Kitwood zu verwenden? Ist es trotz knapper Ressourcen überhaupt möglich, mehr Individualisierung in der Versorgung zuzulassen, etwa im Krankenhaus?
Unser Fallbeispiel:
Die 84-jährige demenzkranke ehemalige Gärtnerin Renate Peters liegt seit zwei Tagen auf der inneren Station eines Krankenhauses. Sie wurde zuvor als Notfall eingewiesen, obwohl mit Ausnahme ihrer Demenzerkrankung bis zu diesem Vorfall keine weiteren Beschwerden festgestellt worden sind. Sehr schnell nach der Einlieferung wird klar, dass die alte Dame eine Überzuckerung hatte. In der Folgezeit werden ständig neue Untersuchungen durchgeführt, ohne auf die individuellen Bedürfnisse von Frau Peters näher einzugehen, was zur Folge hat, dass sich die Dame immer weiter zurückzieht, nachdem sie zuvor häufiger im Krankenhaus auf den Gängen umherlief oder immer wieder verzweifelt versuchte, ihre Tochter telefonisch zu erreichen.
Ich muss bei diesem Fallbeispiel gerade an eine Theorie aus der Managementforschung denken: die XY-Theorie. Der amerikanische Managementvordenker und Soziologe Douglas McGregor hat erforscht, mit welchen Grundannahmen Führungskräfte ihren Mitarbeitern begegnen (McGregor 2005). McGregor unterscheidet im Kern zwei grundverschiedene Menschenbilder oder Theorien:
Theorie X: Führungskräfte, die diese Theorie über ihre Mitarbeiter oft unbewusst im Kopf haben, glauben, dass Menschen eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Deshalb müssen sie stramm gelenkt, geführt und mit besonderen Anreizen motiviert werden. Der Mitarbeiter vom Typ X scheut Verantwortung und Selbstständigkeit.
Theorie Y: Diese Grundannahme beschreibt den Menschen als von Natur aus leistungsbereit und aus sich selbst heraus motiviert. Wenn sich Mitarbeiter vom Typ Y mit den Zielen und Werten des Unternehmens identifizieren, sind externe Kontrollen und Anreize überflüssig.
Wieso dieser Vergleich? Theorie X erinnert in gewisser Weise an “bösartige Sozialpsychologie” – der Mensch als kontrollierbares Objekt, als defizitäres Wesen, während Theorie Y das Personsein in den Vordergrund rückt, und zwar im Hinblick auf die Selbstständigkeit.
Wir können dieses Setting auch auf die Versorgungssituation im Krankenhaus übertragen. Nach Theorie X sehen wir das Objekt, während wir nach Theorie Y den Menschen betrachten. Für den Mediziner wird das allerdings nicht immer einfach sein, ist er doch mehr darin trainiert, in Objektverhältnissen zu denken, beispielsweise als Chirurg. Das ist selbstverständlich keine “bösartige Sozialpsychologie”, wohl aber eine Objektkonstellation. Bemerkenswert ist dabei vor allem die Frage, wann der personzentrierte Blick – auch innerhalb der Versorgung im Krankenhaus – zu mehr Effizienz führt. Oder anders formuliert: Werden die falschen Dinge effizient getan, so kann es trotzdem zur Verschwendung kommen.
Fazit: Wie sehen die Folgekosten aus?
In unserem Fallbeispiel dreht sich alles um Objekte: Auch wenn die Schwester zu Frau Peters in ihr Zimmer im Krankenhaus kommt, fragt sie nicht nach ihrem Wohlbefinden, sondern kommt zu festen Zeiten an ihr Krankenbett, um passend zu weiteren Zuckerprofilen und Untersuchungen Frau Peters Blut abzunehmen. Wir wissen jedoch aus der Versorgungsforschung, dass der Übergang vom Krankenhaus zurück in die häusliche Situation nicht selten zu einer dramatischen Verschlechterung des Wohlbefindens von demenzkranken Personen führen kann. Daher könnte man im Falle von Frau Peters auch ökonomisch einwenden: Wie hätte sich ihr Zustand wohl verbessert, wenn die Objektkonstellation in Gesprächen mit der Patientin zumindest für kurze Zeit außer Acht gelassen worden wäre? Denn der psychische Zustand von Frau Peters hat sich leider in unserem Fallbeispiel nach dem Krankenhausaufenthalt sichtlich verschlechtert.
Und wie hätte diese Geschichte anders verlaufen können? Arzt und Krankenschwester hätten zumindest für Momente den Dialog gesucht und danach gefragt, warum Frau Peters eigentlich in den letzten Tagen so unruhig gewesen ist? Und sie hätten wahrscheinlich ebenso schnell erfahren, dass Frau Peters einfach den Kontakt zu ihrer Tochter gesucht hat, nämlich in dem mehrmaligen und tragischerweise gescheiterten Versuch, mit ihr zu telefonieren.
Dabei stehen die Folgekosten in unserem Fallbeispiel tatsächlich in keinem Verhältnis zu den unterlassenen zwischenmenschlichen Dialogen, was das Verhältnis von Kosten und Nutzen anbelangt. Denn jedes auch noch so kurze “echte” Gespräch kann auch eine bedeutsame Intervention beinhalten, die diesen minimalen Aufwand absolut aufwiegen kann.
Weiterführende Literatur:
- Kitwood, T. (2005): Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen. Bern: Hans Huber Verlag.
- McGregor, D. (2006): The Human Side of Enterprise. Siehe dazu auch folgende Online-Quelle: http://www.kean.edu/~lelovitz/docs/EDD6005/humansideofenterprise.pdf.
- Romero, B.; Eder, G. (1992): Selbsterhaltungstherapie (SET): Konzept einer neuropsychologischen Therapie bei Alzheimer-Kranken. In: Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie, Nr. 5.
- Rüsing, D. (2010): Sinnvolle Beschäftigung ist ein Muss. In: pflegen: Demenz, Nr. 15, S. 4-6.
Quellenangabe zum Titelfoto:
Grandma´s hands / Foto: McBeth / flickr.com
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.