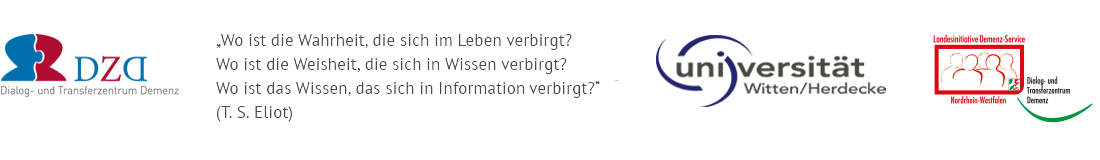Der Soziologe Alain Ehrenberg hat die Depression als gesellschaftliche Störung beschrieben. In diesem Beitrag geht um die medizinisch-psychiatrische Perspektive: Wie hat sich die Klassifikation dieser Krankheit im Laufe der Zeit verändert? Und was hat das mit Demenz zu tun?
Der französische Soziologe Alain Ehrenberg betrachtet die Depression in seinem Buch “Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart” als soziales Phänomen. Das Buch von Ehrenberg wurde erstmals 1998 in Frankreich publiziert und erschien in Deutschland zuerst im Jahr 2004. Die Neuausgabe wurde in diesem Jahr im Campus Verlag veröffentlicht. Die Depression “verquickt das medizinische Leiden mit dem moralischen und gesellschaftlichen Leid” (Ehrenberg 2015: 23). Das gesellschaftliche Leid besteht für Ehrenberg vor allem darin, an den Ansprüchen des modernen Kapitalismus zu scheitern: Ansprüche wie Selbstverwirklichung, Eigenverantwortung, Streben nach Glück und Erfolg. Leere, Depression, Antriebslosigkeit und Suchtverhalten offenbaren die Schattenseiten solcher kapitalistischen Ansprüche wie das “ständige über sich selbst hinauswachsen wollen”.
Auf der anderen Seite – im medizinisch-psychiatrischen Sinne – zeigt die neue Aufmerksamkeit für Depression als Ausdruck der ökonomischen Krise an, wie “deren Traumata und Nöte sich in der Psychiatrie durch die Depression äußern” (Ehrenberg 2015: 243). Insofern kann man die Depression in ihrer Komplexität nicht begreifen, wenn man sie lediglich auf einzelne Symptome reduziert, wie dauerhafte Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Appetitverminderung, Schlaflosigkeit oder innere Unruhe. Dies gilt auch für das Krankheitsbild Demenz: Demenz ist ähnlich komplex wie Depression. Wissenschafler bemühen sich nach wie vor darum, Depression und Demenz “eindeutiger” zu klassifizieren.
Wie sich diese Klassifizierungsversuche aus medizinisch-psychiatrischer Sicht im Laufe der Zeit gewandelt haben, ist der thematische Aufhänger dieses Beitrags. Dabei bildet das bessere Verständnis für die Klassifizierung der Depression die Ergänzung zu meiner Besprechung des Buches von Ehrenberg: Klassiker neu gelesen: Das erschöpfte Selbst_Teil 1.
Klassifikationsversuche früher und heute
Es gibt zwei Zäsuren, die von größerer Bedeutung sind, was die Klassifikation der Depression anbelangt.
Bis Ende der 1960er Jahre gab es keine klare Klassifikation. Um das diagnostische Durcheinander zu überwinden, schlug die Psychiatrie vor, eine genauere Klassifikation der Depression einzuführen. Bis dato bestand das Problem in der Diagnose nämlich darin, dass unterschiedliche Ärzte zu ganz unterschiedlichen Diagnosen kamen, obwohl es sich jeweils um den gleichen Patienten handelte. Wie konnte es zukünftig besser gelingen, zu einer ähnlichen Diagnose zu gelangen? Oder noch besser: Egal welcher Arzt auch zukünftig die Diagnose stellen würde, er wäre aufgrund der neuen Klassifikation dazu in der Lage, zu derselben Diagnose wie sein Kollege zu gelangen: so das Ideal.
Dies blieb allerdings auch weiterhin ein Traum der Medizinforschung; dennoch kam es gegen Ende der 1960er Jahre zu einer grundsätzlichen Veränderung des medizinisch-psychiatrischen Systems, was zukünftige Diagnosen, Einteilungen und Therapien der Depression anbelangte.
Vor dieser Zäsur, vor diesem Einschnitt, wurde die Depression in drei große Gruppen unterteilt: die endogene, die neurotische und die reaktive Depression. Und schließlich wurde die Depression noch danach unterschieden, ob wir es mit einer uni- oder bipolaren Depression zu tun haben.
Zur Erklärung: “Endogen” bedeutet, dass etwas aus inneren Ursachen entsteht. Endogene Depressionen sind vorwiegend erblich bedingte, biologisch fundierte Erkrankungen, auch wenn die wahrscheinlich vielschichtigen biologischen Ursachen noch nicht völlig aufgeklärt und vor allem von der Forschung gesichert sind. Am häufigsten diskutiert man eine “Stoffwechselstörung im Gehirn”, das heißt ein Defizit bestimmter Botenstoffe (Fachausdruck: Neurotransmitter wie Serotonin, Noradrenalin, Dopamin u. a.). Deshalb sprechen diese Art von Depressionen auch besonders gut auf bestimmte Antidepressiva (Psychopharmaka mit stimmungsaufhellender Wirkung) an, die ein solches Botenstoff-Defizit beheben sollen.
Im Kontrast zur “endogenen Depression” steht die “neurotische Depression”. Sie ist eine seelisch bzw. psychosozial bedingte Gesundheitsstörung ohne nachweisbare organische Grundlage. Stimmungstiefs bis hin zu Selbstmordgedanken, Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit, oft in Kombination mit Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen – sind “typische” Symptome einer neurotischen Depression. Allerdings können die Auslöser sehr unterschiedlich sein: etwa Trennungen von einem einst geliebten Menschen oder Jobverlust.
Und dann wäre da noch die “reaktive Depression”, die naturgemäß “exogen” ist, also “von außen” ausgelöst wird. Jemand reagiert auf ein bestimmtes Ereignis depressiv. Diese Art von Depression kann prinzipiell auch die “Gesündesten” und “Ausgeglichensten” treffen. Wir kämpfen täglich mit Problemen, aber manchmal ist die (vor allem plötzliche) Belastung so groß, dass wir darunter zusammenzubrechen drohen.
Schon an dieser Stelle wird vermutlich klar, wie schwierig es unter Umständen in der Diagnose sein kann, klare Abgrenzungen zwischen diesen drei Arten von Depression vorzunehmen. Ein Beispiel: Der Künstler Christoph Schlingensief erkrankte an einem bösartigen Tumor. Es resultierte eine reaktive Depression auf diese Diagnose hin. Er meinte, Gott habe diesen Tumor geschickt. Siehe dazu auch folgenden Blog-Beitrag.
Vorstellbar ist beispielsweise auch bei Demenz, dass mit der Diagnose eine Depression ausgelöst wird. Schließlich kommt bei Demenz noch hinzu, dass diese chronische Krankheit bis dato nicht heilbar ist. Im Gegensatz zur Depression gibt es also eine Diagnose, diverse Klassifizierungen, man spricht gar von ungefähr 50 verschiedenen Demenzformen, jedoch keine Therapiemöglichkeiten, welche die Krankheit besiegen könnten. Therapiert werden bei Demenz vor allem die Begleitsymptome. Personen mit Demenz, die nach der Diagnose zusätzlich an einer Depression leiden, können also durch Therapie die Depression verlieren, jedoch nicht die Demenz.
Und dann wäre da noch die Unterteilung in uni- und bipolare Formen der Depression. Typisch für die unipolare Depression ist, dass manische Phasen fehlen. Leitsymptome sind ausgeprägte Traurigkeit, Freudlosigkeit und Interessenlosigkeit. Eine manische Phase bedeutet für Betroffene etwa, “plötzlich ein leichtes Gefühl wie ein Überflieger zu haben”. Die bipolare Form ist somit im Gegensatz zur unipolaren Form der Depression dadurch gekennzeichnet, dass noch ein weiterer Pol hinzutritt. “Ich bin nicht nur depressiv, sondern meine Stimmungen wechseln gleichfalls auch extrem abrupt von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt.” Auch der Volksmund spricht in diesem Zusammenhang häufig von der “manischen Depression”.
Die nächsten großen Einschnitte
Die drei großen Gruppen, von denen bis dato die Rede war – die endogene, die neurotische und die reaktive Depression – wurden in etwa ab Anfang der 1970er Jahre in ein stark verändertes Diagnose- und Therapie-System überführt. Wesentlich ist dabei zunächst die Wende zum biologischen Zeitalter, präziser formuliert: die Wende zur Psychobiologie. Jede Gemütsbewegegung, so die Grundidee der Psychobiologie, hinterlässt eine biologische Spur in den Organen des Menschen; ein neurologisches Korrelat zu den psychischen Verstimmungen.
Die Depression erscheint vor dieser psychobiologischen Wende nicht mehr als psychiatrisches Syndrom, also als Krankheitsbild, das durch psychische Symptome und durch psychische Phänomene definiert ist, sondern es wird in dieser Zeitphase eher versucht, die Depression als biologisches Problem aufzufassen. Nach dieser Auffassung zufolge geht es darum, für jedes psychische Problem eine neurologische Entsprechung zu finden, um unabhängig von der Person, deren Depression diagnostiziert und therapiert werden soll, ein beforschbares System zu errichten.
“Ich fühle mich schrecklich müde” würde beispielsweise so übersetzt werden, dass das “schrecklich Müdesein der Person” in großem Maßstab in zahlreiche diagnostische Kategorien zerlegt wird, um den Ursachen für das “Müdesein” auf die Spur zu kommen. In der Forschung würde zudem eine weitere Untersuchung vorgenommen werden, in der eine zweite Gruppe von Forschern noch ein zusätzliches statistisches Instrument entwickelt, um die Verlässlichkeit der diagnostischen Forschungskriterien zu bewerten und zu systematisieren.
Ausflug in die Genetik
Diese “Revolution” in der Forschung ist vielleicht noch besser zu verstehen, wenn man die Forschungsergebnisse der Genetik in den letzten 15 Jahren mit berücksichtigt. Mitte der 1990er Jahre benötigte man noch in etwa fünf Jahre und 70 Millionen US-Dollar, um das Genom einer Pflanze names Arabidopsis zu sequenzieren (siehe Bild oben). Heute ist das bereits für weniger als 1.000 US-Dollar in vergleichsweise sehr kurzer Zeit möglich. Was ich damit sagen will, ist, was die Klassifizierung der Depression anbelangt: die Art und Weise, wie heute diagnostiziert wird, hat sich grundsätzlich geändert. Einerseits steht heute in der Forschung die Neurobiologie im Mittelpunkt bzw. die Verbindung von Psychologie und Biologie, andererseits sprechen wir teilweise von unglaublich großen Datensätzen, die in der medizinischen Forschung analysiert und genauer sequenziert werden – Stichwort “Big Data”.
Die erste “Lösung” für das Problem der Heterogenität der Depression bestand also darin, eine Klassifikation vorzunehmen, wie es sie zuvor in dieser Art noch nicht gegeben hatte. “1980 brachte die American Psychiatric Association (APA) eine Klassifikation heraus, in der fast zehn Jahre Arbeit steckten: die dritte Ausgabe des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, besser bekannt unter dem Kürzel DSM-III. Es wurde 1987 teilweise überarbeitet (DSM-III-R), eine vierte Ausgabe erschien 1994 (DSM-IV). Das DSM gab der Psychiatrie weltweit eine neue Wendung” (Ehrenberg 2015: 204). DCM bedeutet: “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder”, auf Deutsch: “diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“.
Neben dieser “neuen Art” Diagnosen zu stellen, Krankheiten wie Depression zu klassifizieren (nach über 25 Kategorien) sowie Therapien anzubieten, hat sich außerdem der Fokus auf psychische und psychiatrische Probleme verschoben: Es ist immer weniger von “Krankheiten” und “Defiziten” die Rede, stattdessen sprechen wir von “mentaler Gesundheit” und werfen beispielsweise bei Demenz den Blick auf Ressourcen, die noch vorhanden sind, statt von Defiziten zu sprechen. Das nenne ich: “Umkehrung des Blickes”.
Fazit
Die Diagnose von solchen Krankheiten wie Depression und Demenz ist heute weitaus genauer, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. So gesehen kann man gewissermaßen von einer “Revolution” sprechen, wenn wir damit zum Ausdruck bringen wollen, welche großen Mengen an Gesundheitsdaten bedingt durch die Digitalisierung vermessen werden können. Auf der anderen Seite wissen wir trotz dieser “Revolution” immer noch nicht so richtig, was Depression und Demenz eigentlich bedeuten; eine gewissen Rätselhaftigkeit bleibt also auch im heutigen Zeitalter der mentalen Gesundheit erhalten. Das Buch “Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft” des französischen Soziologen Alain Ehrenberg liefert zu der Geschichte der Depression einen hervorragenden Überblick – insbesondere in der Frage, worin die Rolle der Depression in der modernen kapitalistischen Gesellschaft besteht, und wie sich die Depression als dauerhafte Erschöpfung in andere Systeme wie Medizin und Psychiatrie “einschreibt”.
Das Buch “Das erschöpfte Selbst” von dem französischen Soziologen Alain Ehrenberg ist im Campus Verlag erschienen. Hier der Link zum Buch.
Quellenangaben zu den Fotos:
Foto: Neil Moralee / www.flickr.com
Foto: Great Lakes Bioenergy Research Center / www.flickr.com
Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.