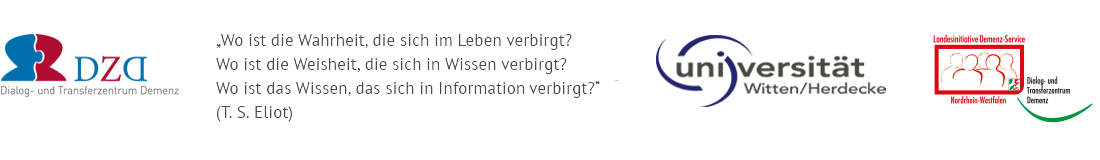Häufig wird es den Ärzten überlassen, welche Medikamente verabreicht werden, wenn neurologisch bedingte “herausfordernde Verhaltensweisen” bei Menschen mit Demenz auftreten. Insbesondere in solchen Fällen, wenn psycho-soziale Interventionen nicht funktionieren, etwa bei Depression. Dabei kann der Einsatz von einzelnen Medikamenten in solchen Fällen verheerende Folgen nach sich ziehen.
In diesem Beitrag möchte ich einen wesentlichen, aber in meinen Augen stark vernachlässigten Aspekt hinsichtlich der Aufgaben der Pflegenden bei der medikamentösen Versorgung insbesondere Demenzerkrankter in den Blick nehmen.
Es geht insbesondere darum, welche Aufgaben auf Pflegende in der Verabreichung von Medikamenten zukommen, wenn sogenannte “herausfordernde Verhaltensweisen” bei Demenzbetroffenen wie unter anderem Depression oder Wahn und Halluzinationen auftreten und psychso-soziale Interventionen nicht mehr weiterhelfen.
Interventionen wie körperliche Aktivität, Musik- und Tanztherapie, Massagen und Berührungen, also sämtliche Möglichkeiten, die das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz verbessern können, gerade auch wenn depressive Verstimmungen und derartige Symptome existieren.
Welche Aufgaben kommen also in der Vergabe von Medikamenten auf professionell Pflegende zu, wenn psycho-soziale Interventionen nicht mehr richtig funktionieren? Warum sollten sich Pflegende in solchen Fällen intensiver mit Medikamenten und deren Wirkungsweisen auseinandersetzen?
“Aus dieser studienbasierten Empfehlung wird deutlich, dass derartige Medikamente also möglichst kurz (als Intervention) gegeben werden sollten, da sie unter Umständen neben dem gewünschten Effekt die Gefahr von beispielsweise Hirninfarkten und einer Verkürzung der Lebenszeit implizieren.”
Medikamentöse Therapien
Die Arbeit professionell Pflegender ist in hohem Maße zunächst einmal bedeutsam für die medizinische Diagnostik im Vorfeld einer möglichen Medikamentenverschreibung für den behandelnden Arzt/Facharzt.
Wir Pflegenden verbringen – vor allem in der stationären Betreuung – mehr Zeit als jede andere Person mit den zu Betreuenden. Bereits darin begründet liegt die wesentliche Aufgabe der Beobachtung und Identifikation von physischen oder psychischen Veränderungen betreuter Personen. Zudem können Beobachtungen von Pflegenden und die damit verbundene Dokumentation zur Entdeckung organischer Erkrankungen (z.B. Diabetes, Herzerkrankungen usw.) führen. Ebenso ist die Identifikation möglicher Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder depressiver Episoden nur über strukturierte, dokumentierte und im Teamaustausch verifizierte Beobachtungen möglich.
Diese Beobachtungen können nur von Personen gemacht und bewertet werden, die Zeit mit den zu Pflegenden verbringen. Zudem braucht es neben emphatischem Umgang vor allem auch Wissen, um überhaupt in der Lage zu sein, Veränderungen zu entdecken und diese zu diskutieren und zu bewerten. Erst an dieser Stelle kommen Medizinerinnen und Mediziner ins Spiel, mit denen Pflegende auf Augenhöhe ihre Beobachtungen diskutieren können und die dann in der Folge die Aufgabe haben, mit den Pflegenden und natürlich den Betroffenen selbst (ja … – auch mit demenzerkrankten Personen) einen möglicherweise notwendigen Therapieplan zu besprechen und Medikamente zu verordnen.
Der zweite große Aufgabenbereich – bei unvermeidbarer Medikamenteneinnahme – besteht in der Unterstützung der Betroffenen bei der Einnahme und der Überwachung der Wirkung des eingenommenen Präparates. Ebenso wie bei der Diagnostik sind die verordnenden Mediziner auch bezüglich der tatsächlichen Wirkung abhängig von der strukturierten und dokumentierten Beobachtung der Erkrankten durch die Pflegenden.
Bei der Einnahme von Medikamenten kann es zu erwünschten Wirkungen und/oder Nebenwirkungen und/oder Wechselwirkungen der Medikamente mit anderen Pharmazeutika kommen. Das Auftreten von Nebenwirkungen und/oder Wechselwirkungen wiederum kann zu einer Änderung der medikamentösen Therapie führen. Dies wiederum wird aber erst dadurch möglich, dass derartige Wirkungen von dem Betroffenen selbst und/oder von Pflegenden nach Beobachtung und Befragung des zu Pflegenden dokumentiert und an den verschreibenden Arzt weitergeleitet werden.
Auch hier kommt den Pflegenden – insbesondere bei beeinträchtigter Äußerungsfähigkeit der Erkrankten eine bedeutsame und prozessentscheidende Rolle und große Verantwortung zu. Im Falle des Eintrittes der beabsichtigten Wirkung des Präparates wiederum sind die Pflegenden ebenso aufgefordert und in der Pflicht, dies entsprechend nach Beobachtung und Befragung zu dokumentieren und an den verantwortlichen Mediziner weiterzugeben.
In den Zeilen zuvor wurde beschrieben, welche Aufgaben Pflegende haben, um festzustellen und zu handeln, wenn ein verschriebenes Medikament zu Beginn oder im späteren Verlauf der Einnahme unerwünschte Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten verursacht. Was aber passiert, wenn eine Medikamentengabe hinsichtlich der Behandlung von Symptomen oder Ursachen erfolgreich ist? Nehmen wir ein Beispiel. Wahnvorstellungen und Halluzinationen sind „herausfordernde Verhaltensweisen“ (Bartholomeyczik et al. 2007), welche im Laufe verschiedenster Demenzerkrankungen auftauchen können.
In diesen Fällen kann es von Nutzen sein (die Leitlinie empfiehlt den Einsatz des Wirkstoffes Risperidon), diese mit entsprechenden Psychopharmaka zu behandeln. Tatsache ist aber auch, dass zum einen derartige Symptome häufig nur zeitweise auftreten und bei Fortschreiten der Demenz in den Hintergrund treten oder ganz verschwinden können.
Zum anderen ist die Einnahme von Antipsychotika – je nach Wirkstoff – nicht ungefährlich. Die auf der Auswertung umfangreicher Studien gegebene Empfehlung Nr. 55 in der der genannten S§-Leitlinie lautet folgendermaßen: „Die Gabe von Antipsychotika bei Patienten mit Demenz ist wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für Mortalität und für zerebrovaskuläre Ereignisse assoziiert. […]. Das Risiko ist in den ersten Behandlungswochen am höchsten, besteht aber wahrscheinlich auch in der Langzeitbehandlung. Es besteht ferner wahrscheinlich das Risiko für beschleunigte kognitive Verschlechterung durch die Gabe von Antipsychotika bei Demenz. Patienten und rechtliche Vertreter müssen über dieses Risiko aufgeklärt werden. Die Behandlung soll mit der geringstmöglichen Dosis und über einen möglichst kurzen Zeitraum erfolgen. Der Behandlungsverlauf muss engmaschig kontrolliert werden (Deuschl, Maier 2016; S. 72)
Aus dieser studienbasierten Empfehlung wird deutlich, dass derartige Medikamente also möglichst kurz (als Intervention) gegeben werden sollten, da sie unter Umständen neben dem gewünschten Effekt die Gefahr von beispielsweise Hirninfarkten und einer Verkürzung der Lebenszeit implizieren.
Dieses Wissen wiederum bedeutet natürlich nicht nur etwas für verschreibende Mediziner! Wenn einige Psychopharmaka für eine Krisenintervention notwendig sind, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sie nach überstandener Krise weiterhin gegeben werden müssen. Wir alle wissen, dass – gerade bei Visiten in Altenheimen – zumeist die Dinge besprochen werden, die die entsprechende Pflegekraft anspricht.
Meine Frage an Sie: Wie oft haben Sie einen behandelnden Mediziner schon gefragt, ob ein Medikament (Antopsychiotikum, Schlafmittel, Antidepressivum usw.) weiterhin gegeben werden muss?
Wenn Sie dies regelmäßig machen, sind Sie auch in diesem Punkte und Aufgabengebiet professioneller Pflege vorbildlich und professionell. Aus meiner Erfahrung allerdings weiß ich, dass viele alte Menschen manche Medikamente über Jahre bekommen, ohne dass gefragt wird, ob die noch einen Nutzen haben.
Warum nicht alleine Mediziner für die Verabreichung von Medikamenten verantwortlich sind
Man könnte sagen, dass die Überprüfung der Notwendigkeit der Weiterführung einer Medikation in der Verantwortung der Mediziner liegt. Das stimmt auch. Das entbindet uns aber als Pflegefachkräfte nicht davon, Mediziner darauf hinzuweisen, was überprüft werden müsste. Das gehört zu unseren Aufgaben im Pflegeprozess. Und das geht nur, wenn ich zu den entsprechenden Themen über Wissen verfüge und ich mich auf dem Laufenden halte.
Darum: Lesen Sie sich einmal die S3-Leitline zur Behandlung bei Demenzen durch (siehe Literaturangaben)! Das Verstehen der Empfehlungen ist wahrlich kein Hexenwerk. Schlau genug sind wir Pflegenden allemal … – und wenn Sie etwas nicht verstehen: Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Menschen mit Demenz werden es Ihnen danken!
Quelle zum verwendeten Bild im Titel:
Photo credit: FotoDB.de via Visual Hunt / CC BY-NC-SA
Weiterführende Literatur und Internet-Quellen:
- Bartholomeyczik, S. et al. (2007): Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit. Online: http://siegel.dggpp.de/Rahmenempfehlungen_herausf_Verhaltene.pdf
- Deuschl G, Maier W et al. S3-Leitlinie Demenzen. 2016. In: Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Hrsg. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: https://www.dgn.org/leitlinien/3176-leitlinie-diagnose-und-therapie-von-demenzen-2016
Quellenangabe zum Titelfoto:
Foto: FotoDB.de / www.VisualHunt.de
Detlef Rüsing ist Pflegewissenschaftler und leitet das Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) an der Universität Witten/Herdecke. Rüsing verfügt ebenso über langjährige praktische Erfahrungen in der Alten- und Krankenpflege: Er hat dort über 16 Jahre gearbeitet. Seine Schwerpunkt liegt auf Theorie-Praxis-Transfer. Daneben ist er Herausgeber von “pflegen: Demenz. Zeitschrift für die professionelle Pflege von Personen mit Demenz”. Kontakt: detlef.ruesing@uni-wh.de.